Neues aus der GMS

Einführung der Zürich City Card
Der Zürcher Stadtrat hat als Antwort auf eine Motion vom Herbst 2018 die Einführung der Züri City Card beschlossen.
Er schlägt einen amtlichen Ausweis vor, der allen in Zürich lebenden Menschen ausgestellt wird – unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus und ihren individuellen Voraussetzungen. Dadurch soll die Teilnahme am öffentlichen Leben und an städtischen Dienstleistungen und Angeboten ermöglicht werden. Die Grundlage für diesen Entscheid bilden zwei vom Stadtrat in Auftrag gegebene Rechtsgutachten der Universität Zürich. Diese halten fest, dass eine Züri City Card weder Bundes- noch kantonales Recht verletzt. Weist die Karte die notwendigen Angaben wie Name, Geburtsdatum und Foto auf, reicht sie der Stadtpolizei zur Identitätsfeststellung.
Alle Informationen zur Einführung der Zürich City Card findest Du hier
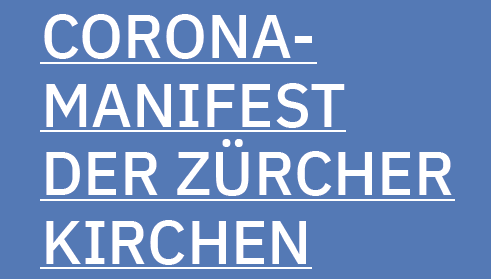
Corona-Manifest der Zürcher Kirchen
Die reformierte Kirche Stadt Zürich hat – unter der Leitung von Christoph Sigrist (Präsident der GMS) in seiner Funktion als Pfarrer am Grossmünster – zusammen mit der katholischen und der christkatholischen Kirche der Stadt Zürich ein gemeinsames Versprechen abgelegt, wie die Kirche während der Corona-Krise für die von Corona besonders betroffenen Menschen, namentlich die Kranken und Alten, da sein will. Dieses Versprechen ist im sogenannten «Corona-Manifest» in Form von sieben Leitsätzen zusammengefasst und wurde am 11. November, dem Martinitag, in einem feierlichen Akt im Grossmünster von den beteiligten Parteien unterzeichnet.
Hier geht’s zum Corona-Manifest:
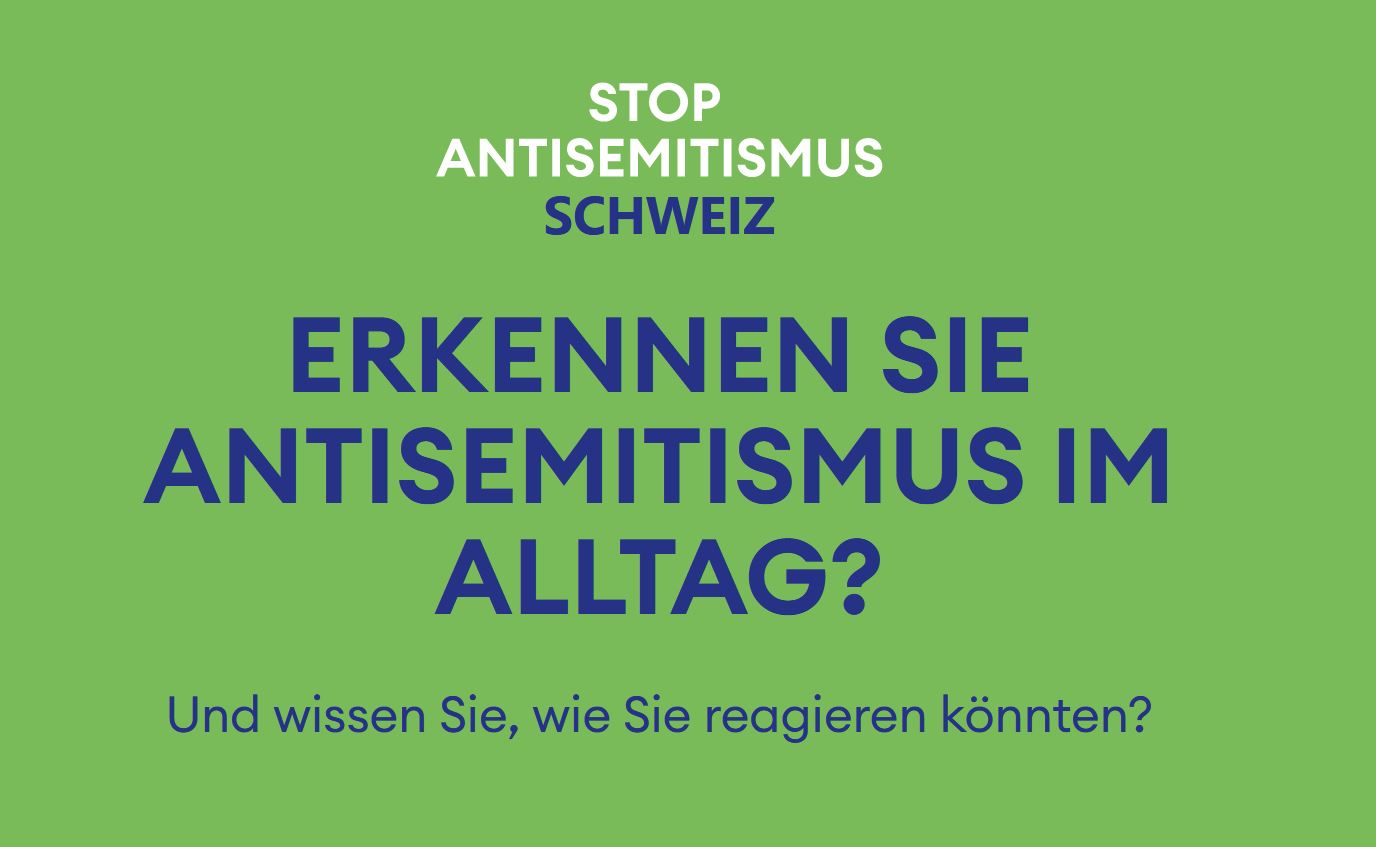
Antisemitismus bekämpfen – mit neu lancierter Website
Zum Gedenktag an die Reichspogromnacht lanciert die GRA (Partnerorganisation der GMS) zusammen mit einem bisher einzigartigen Zusammenschluss an Expertinnen und Experten die Website stopantisemitismus.ch.
Antisemitismus geht uns alle etwas an. Denn judenfeindliche Sprache kann überall vorkommen, wie jüngst eine Umfrage bei Schweizer Jüdinnen und Juden ergab − ob auf dem Schulhof, im öffentlichen Verkehr, im Internet oder am Arbeitsplatz. Doch wie reagieren, wenn der Onkel während dem Familienessen plötzlich antisemitische Parolen schwingt? Und was tun, wenn der Mitschüler plötzlich stereotypische Bilder von Juden wiedergibt? Um in solchen Situationen richtig reagieren zu können, lanciert die GRA in Zusammenarbeit mit einem bisher einzigartigen Zusammenschluss an Expertinnen und Experten die Website stopantisemitismus.ch.
Während bestimmte antisemitische Aussagen bewusst getätigt werden, wiederholen viele Menschen antisemitisches Gedankengut ohne sich dessen bewusst zu sein. Als Zeuge solcher Aussagen weiss man oft nicht, wie reagieren und bleibt als Zuhörer ratlos zurück. Stopantisemitismus.ch hilft, solchen Situationen bestimmt entgegenzutreten. Auf der Website finden Sie reale Beispiele antisemitischer Aussagen aus dem Schweizer Alltag, wie sie regelmässig auf der Strasse, im Bekanntenkreis, in Online-Medien oder in Leserbriefen vorkommen. Wir zeigen, was an solchen Aussagen problematisch ist, wie man reagieren und an wen man sich wenden kann.
Das Projekt «Stop Antisemitismus» wurde von der deutschen Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius 2018 initiiert und gemeinsam mit Partnern umgesetzt. stopantisemitismus.ch ist dabei das Schweizer Pendant zur deutschen Originalwebsite stopantisemitismus.de.

GMS-Standpunkt «Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Sans-Papiers in Zürich»
Sans-Papiers sind Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus. Entweder wurde ihr Asylgesuch rechtskräftig abgelehnt oder sie haben ihre Aufenthaltsbewilligung verloren. Es gibt auch Sans-Papiers, die nie ein Asylgesuch gestellt haben oder eine Arbeitsbewilligung hatten. Im Auftrag des Amtes für Wirtschaft und Arbeit und des Amtes für Migration des Kantons Zürich haben die beiden Beratungsbüros ECO-Plan und KEK-Beratung dieses Jahr eine Studie über Sans-Papiers im Kanton Zürich durchgeführt, gemäss dieser leben schätzungsweise bis zu 24’900 Sans-Papiers im Kanton Zürich.
Während des Lockdowns hat sich die Lebenssituation der Sans-Papiers massiv verschlechtert und ihre ohnehin vielfältigen Probleme wurden sichtbarer und grösser. Die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Sans-Papiers verfestigten sich in den verschiedenen Lebensbereichen:
Einkommensverlust
Viele Sans-Papiers waren in Privathaushalten und in prekären Arbeitsverhältnissen tätig. Die meisten Arbeitgeber wollen wegen der Pandemie keine Risiken eingehen. Durch den Lockdown und die Arbeit im Homeoffice haben viele ihre Arbeit verloren. Dadurch haben sie kein Einkommen mehr, und auch keinen Anspruch auf Sozial- oder Arbeitslosenhilfe. Von einem Tag auf den anderen haben sie ihre Existenzgrundlage verloren.
Soziale Isolation
Sans-Papiers leben am Rande der Gesellschaft, sie gehen möglichst unauffällig von zu Hause zur Arbeit und umgekehrt. Freizeitaktivitäten bergen das Risiko, entdeckt und ausgeschafft zu werden und werden deshalb selten praktiziert. Wegen der Pandemie werden an vielen Orten die Besucher*innen registriert, was für Sans-Papiers nicht möglich ist, da sie unerkannt bleiben müssen oder sich nicht ausweisen können. Das bedeutet, überall ausgeschlossen zu sein.
Ausbildung (Deutschkurse)
Sans-Papiers können sich keine bezahlten Deutschkurse leisten. Sie profitieren von kostenlosen Deutschkursen in der Autonome Schule Zürich oder vom Solidaritätsnetz Zürich. Während des Lockdowns waren die Deutschkurse nur via Fernunterricht möglich. Dazu brauchte es aber Internetzugang und Computer, für viele Sans-Papiers ein unüberwindbares Hindernis.
Ernährung
Es gibt Sans-Papiers, die nur dank verschiedenster Hilfs-Angebote über die Runden kommen, zum Beispiel durch Lebensmittelabgaben oder Orte, an denen sie günstig essen können. Auch diese Angebote wurden während des Lockdowns geschlossen. Jetzt funktionieren zwar einige dieser Hilfsangebote wieder, aber der Zugang zu Lebensmitteln ist immer noch schwieriger als vor der Pandemie.
Mobilität
Die Kosten für die Mobilität sind für tiefe Einkommen, wie sie bei Sans-Papiers üblich sind, relativ hoch. Neu kommt die Pflicht dazu, Masken zu tragen. Das ist mit zusätzlichen Kosten verbunden und schränkt dadurch die Mobilität der Sans-Papiers noch mehr ein.
Gesundheit
Viele Sans-Papiers haben keine Krankenkasse und können so in der Regel keinen Arzt aufsuchen. Bei einem Coronatest aber müssten sie sich ausweisen können. Da das nicht möglich ist, können sie sich auch nicht testen lassen, auch wenn sie Symptome aufweisen.
Hilfsangebote für Sans-Papiers
Glücklicherweise gab es während des Lockdowns neue Projekte, wie das Projekt «Essen für Alle». Dank diesem können Menschen in Not einmal wöchentlich ein Paket mit Grundnahrungsmitteln und Gemüse beziehen. Es enthält Öl, Reis, Mehl, Kartoffeln, Zwiebeln und Tomatensaft, zusätzlich werden Gemüse und Früchte abgegeben.
Die Sans-Papiers Anlaufstelle Zürich SPAZ hat während des Lockdowns neben dem üblichen Unterstützungsangebot mit Hilfe von Spendengeldern die Kosten für Mieten und Krankenkassen übernommen. Auch unterstützten sie Sans-Papiers, falls sie Notfallbehandlungen brauchten.
In der Autonomen Schule können Sans-Papiers alle angebotenen Kurse besuchen. Dazu gehören verschiedene Sportangebote und Sprachkurse.
Daneben unterstützen das Schweizerische Rote Kreuz, die Caritas, das Sozialwerk Pfarrer Sieber und andere Hilfswerke die Sans-Papiers mit kleinen Geldbeiträgen, Kleidern, Lebensmitteln und Übernachtungsangeboten. Trotz dieser grossen Solidarität bleibt die Situation für Sans-Papiers aber sehr schwierig und viele leben in äusserst prekären Verhältnissen.

Standpunkt der GMS zur Begrenzungsinitiative: Warum der GMS die Begrenzungsinitiative der SVP nicht gleichgültig sein kann (en allemand)
Eigentlich hätte diese Initiative am 17. Mai 2020 zur Abstimmung kommen sollen. Wegen
der Corona-Krise wurde der Urnengang abgesagt. Die Abstimmung soll zu einem
späteren Zeitpunkt stattfinden, wahrscheinlich im September.
Die Initiative will die Personenfreizügigkeit mit der EU beenden und ihre Annahme hätte zur Folge, dass die Bilateralen Verträge mit der EU gekündigt werden müssten. Das einvernehmliche Verhältnis der Schweiz mit der Europäischen Union steht also mit dieser Initiative auf dem Spiel. Damit würde die Schweiz auf einen Pfad der Abschottung gezwungen, der nichts Gutes für das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft bedeuten würde, sowohl hier in der Schweiz wie auch zwischen der Schweiz und Europa.
Die Vorboten dieser Abschottung finden sich in den Argumenten der Befürworter der Initiative. Die Hauptbotschaft lautet: die SchweizerInnen leiden unter den Zugewanderten, diese sind die Sündenböcke für alles, was von den Initianten als negativ empfunden wird: überfüllte Züge und Strassen, die Gefährdung von Arbeitsplätzen für ältere Personen, knapper und teurer Wohnraum, steigende Mieten und Hauspreise, zubetonierte Landschaft, überfüllte Schulen, unsicherer öffentlicher Raum, Gewalt gegen Frauen, steigende Sozialhilfeausgaben. Obwohl die SVP sich bisher weder für die Anliegen der Mieterinnen und Mieter, für die
Gleichstellung der Frauen, für einen gut ausgebauten öffentlichen Verkehr, noch für ein starkes Sozialwesen stark gemacht hat – im Gegenteil – missbraucht sie alle diese Themen, um gegen die «Fremden» Stimmung zu machen. Selbst das Artensterben wird den Zugewanderten in die Schuhe geschoben. Die Partei hat sich zwar noch nie für den Umweltschutz stark gemacht und leugnet sogar den Klimawandel, aber in ihrem Hass auf alles Fremde ist ihr sogar das «grosse Sterben der Insekten» gut genug, um damit gegen die Zugewanderten zu
polemisieren.
Die ganze Argumentationskette ist zutiefst fremdenfeindlich, sie verstärkt ganz bewusst eine negative Einstellung gegenüber allem als Unschweizerisch empfundenem. Die Opfer dieser Polemik und Unterstellungen sind Zugewanderte, Dunkelhäutige, Anderssprachige, Andersgläubige. Und da sich die GMS stark macht für die Minderheiten in der Schweiz, ist es klar, dass sie diese Initiative bekämpft. Letztere will bewusst eine Mauer zwischen uns und den «andern» errichten, sie will Privilegien ausschliesslich für SchweizerInnen. Das alles widerspricht zutiefst all dem, wofür sich die GMS stark macht. Unser Slogan lautet nicht umsonst: «Die Stärke einer Gesellschaft misst sich am Wohl der Schwachen.» Wir setzen uns für Leben, Recht, Kultur und Integration alter und neuer Minderheiten in der Schweiz ein, in dieser Denkweise hat eine SVP-Begrenzungsinitiative keinen Platz.

Standpunkt der GMS zur Begrenzungsinitiative: Warum der GMS die Begrenzungsinitiative der SVP nicht gleichgültig sein kann
Eigentlich hätte diese Initiative am 17. Mai 2020 zur Abstimmung kommen sollen. Wegen
der Corona-Krise wurde der Urnengang abgesagt. Die Abstimmung soll zu einem
späteren Zeitpunkt stattfinden, wahrscheinlich im September.
Die Initiative will die Personenfreizügigkeit mit der EU beenden und ihre Annahme hätte zur Folge, dass die Bilateralen Verträge mit der EU gekündigt werden müssten. Das einvernehmliche Verhältnis der Schweiz mit der Europäischen Union steht also mit dieser Initiative auf dem Spiel. Damit würde die Schweiz auf einen Pfad der Abschottung gezwungen, der nichts Gutes für das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft bedeuten würde, sowohl hier in der Schweiz wie auch zwischen der Schweiz und Europa.
Die Vorboten dieser Abschottung finden sich in den Argumenten der Befürworter der Initiative. Die Hauptbotschaft lautet: die SchweizerInnen leiden unter den Zugewanderten, diese sind die Sündenböcke für alles, was von den Initianten als negativ empfunden wird: überfüllte Züge und Strassen, die Gefährdung von Arbeitsplätzen für ältere Personen, knapper und teurer Wohnraum, steigende Mieten und Hauspreise, zubetonierte Landschaft, überfüllte Schulen, unsicherer öffentlicher Raum, Gewalt gegen Frauen, steigende Sozialhilfeausgaben. Obwohl die SVP sich bisher weder für die Anliegen der Mieterinnen und Mieter, für die
Gleichstellung der Frauen, für einen gut ausgebauten öffentlichen Verkehr, noch für ein starkes Sozialwesen stark gemacht hat – im Gegenteil – missbraucht sie alle diese Themen, um gegen die «Fremden» Stimmung zu machen. Selbst das Artensterben wird den Zugewanderten in die Schuhe geschoben. Die Partei hat sich zwar noch nie für den Umweltschutz stark gemacht und leugnet sogar den Klimawandel, aber in ihrem Hass auf alles Fremde ist ihr sogar das «grosse Sterben der Insekten» gut genug, um damit gegen die Zugewanderten zu
polemisieren.
Die ganze Argumentationskette ist zutiefst fremdenfeindlich, sie verstärkt ganz bewusst eine negative Einstellung gegenüber allem als Unschweizerisch empfundenem. Die Opfer dieser Polemik und Unterstellungen sind Zugewanderte, Dunkelhäutige, Anderssprachige, Andersgläubige. Und da sich die GMS stark macht für die Minderheiten in der Schweiz, ist es klar, dass sie diese Initiative bekämpft. Letztere will bewusst eine Mauer zwischen uns und den «andern» errichten, sie will Privilegien ausschliesslich für SchweizerInnen. Das alles widerspricht zutiefst all dem, wofür sich die GMS stark macht. Unser Slogan lautet nicht umsonst: «Die Stärke einer Gesellschaft misst sich am Wohl der Schwachen.» Wir setzen uns für Leben, Recht, Kultur und Integration alter und neuer Minderheiten in der Schweiz ein, in dieser Denkweise hat eine SVP-Begrenzungsinitiative keinen Platz.

Standpunkt der GMS zum Burkaverbot (en allemand)
In der Schweiz soll niemand in der Öffentlichkeit sein Gesicht verhüllen und niemand eine Person zwingen dürfen, ihr Gesicht aufgrund ihres Geschlechts zu verhüllen. Das fordert die Initiative «Ja zum Verhüllungsverbot», welche von SVP-nahen Kreisen eingereicht und vom Parlament und Bundesrat in der Sommersession zur Ablehnung empfohlen wurde. Darüber wird es bald eine Volksabstimmung geben.
Der Gegenvorschlag zur sogenannten Burka-Initiative sieht vor, dass alle, die sich im öffentlichen Verkehr oder bei Behörden identifizieren müssen, die gesetzliche Pflicht haben, das Gesicht zu zeigen. Er fand in beiden Räten eine Mehrheit, kommt als indirekter Gegenvorschlag aber nicht zur Abstimmung.
Das Egerkinger Komitee um den SVP-Nationalrat Walter Wobmann zielt mit der Burka-Initiative nach der Minarettverbotsinitiative zum zweiten Mal auf die muslimische Gemeinschaft in der Schweiz. Diesmal geschieht es im Namen der Geschlechtergleichheit. Denn die Burka wird, wenn überhaupt, ausschliesslich von muslimischen Frauen getragen. Es wird auf ein augenfälliges und mit viel Symbolik aufgeladenes Kleidungsstück gezielt, statt dass über die Hintergründe von Diskriminierung und Ausschluss aufgrund des Geschlechts oder der kulturellen und religiösen Herkunft gesprochen wird. Es wird eine Stellvertreterdebatte geführt, die sich gegen «den Islam» in unserer Gesellschaft richtet. Statt Integrationsschranken beim Zugang zu Bildung, Arbeit und politischen Rechten abzubauen, reden die InitiantInnen lieber von einer angeblichen Integrationsunwilligkeit und Integrationsunfähigkeit der muslimischen Bevölkerung. Sie orten das Problem im Islam, der mit unseren westlichen Werten inkompatibel sei. Es wird ein einseitiges und pauschales Bild eines patriarchalischen und frauenfeindlichen Islam gezeichnet, was gerade in der Schweiz so nicht der Realität entspricht.
Wenn es den Initianten wirklich um die Würde der Frau ginge, müsste es ihnen aber um die Würde aller Frauen in unserer Gesellschaft gehen. Sie haben sich aber nie für feministische Kampagnen gegen Sexismus in der Werbung, gegen die Pornografisierung von Frauenkörpern zu Werbezwecken oder für griffige Gesetze gegen den Frauenhandel stark gemacht. Pauschal von der Unterdrückung muslimischer Frauen auszugehen, wie dies das Egerkinger Komitee tut, ist Ausdruck eines Paternalismus, der den muslimischen Frauen keinerlei Handlungsmacht zuspricht. Zudem wird mit dem Burka-Verbot ein neues «Sondergesetz» für Musliminnen geschaffen.
Die GMS propagiert das Tragen einer Burka in keiner Weise, weil sie die Freiheit der Frauen einschränkt. Es ist für die GMS auch ganz klar, dass keine Frau zur Verhüllung gezwungen werden darf. Wenn aber eine Frau, die hier lebt, entscheidet, dass sie sich, aus welchen Motiven auch immer, verschleiern will, dann muss unsere freiheitliche Rechtsordnung das zulassen. Der Staat darf nicht das Tragen bestimmter Kleidungsstücke verbieten und damit in die persönliche Freiheit der Menschen eingreifen. Die Initiative fokussiert zudem auf ein Problem, das in der Schweiz kaum existiert, verstärkt aber die Vorurteile gegen muslimische Gruppen und fördert ein Klima der Intoleranz. Deshalb leiden religiöse Minderheiten oft an Ausgrenzung und Diskriminierung. Die umfassende Durchsetzung der Religionsfreiheit ist für alle gläubigen Menschen von grundlegender Bedeutung. Selbstverständlich aber müssen sich alle Religionen an der Respektierung der Menschen- und Frauenrechte messen lassen. Gerade was die Umsetzung der Frauenrechte anbelangt, sind die meisten Religionen schwer im Verzug.
Die GMS kämpft gegen die Instrumentalisierung von Frauenrechten als emotionale Mobilisierungsstrategie für eine fremdenfeindliche Politik. Wir unterstützen Massnahmen, die das Selbstbestimmungsrecht von Frauen im Allgemeinen und der Migrantinnen im Besonderen schützen und fördern, sowie die Diskriminierung von religiösen und anderen Minderheiten beheben. Da die Burka-Initiative all diesen Bemühungen zuwiderläuft, bekämpft sie die GMS, wie das alle anderen Schweizer Menschenrechtsorganisationen auch tun.

Standpunkt der GMS zu den Vorfällen in den USA und zu Polizeigewalt und Rassismus in der Schweiz (en allemand)
Die jüngsten Fälle von Polizeigewalt an Afroamerikaner*innen in den Vereinigten Staaten erschüttern die Welt. Erstmals werden die schrecklichen Morde, etwa an George Floyd oder Ahmaud Arbery, auf Video aufgezeichnet und so sichtbar gemacht. Unverhältnismässige Polizeigewalt an Menschen mit dunkler Hautfarbe ist in den USA allerdings kein neues Thema. Zusammen mit weiteren Erscheinungsformen strukturellen und systemischen Rassismus ist dies Ausfluss einer jahrhundertlangen Geschichte von Kolonialismus, Sklaverei und Segregation. Die systematische und legalisierte Unterdrückung von People of Color zu Gunsten von weissen Privilegien hat noch heute Auswirkungen, sei es etwa durch breite Chancenungleichheit oder sonstige Benachteiligungen und Diskriminierungen. Obwohl die Black Lives Matter Bewegung bereits vor sieben Jahren ins Leben gerufen wurde, hat Polizeigewalt an Menschen mit dunkler Hautfarbe in Amerika sogar noch zugenommen.
Die GMS zeigt Solidarität mit Black Lives Matter und verurteilen die Ereignisse in den USA auf das Höchste. Polizeigewalt, struktureller und systemischer Rassismus sind jedoch nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa und der Schweiz gegenwärtig. Die Schweiz hat ihre eigene politische und gesellschaftliche Realität, in der Rassismus gegen People of Color und andere Minderheiten leider auch ein Thema ist. Der Bericht der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus EKR und humanrights.ch zu Rassismusfällen aus der Beratungspraxis meldet für das Jahr 2019 insgesamt 352 Beratungsfälle. Es versteht sich von selbst, dass diese Fälle nur die «Spitze des Eisbergs» der rassistischen Vorfälle in der Schweiz darstellen. Der Bericht verdeutlicht, dass auch in der Schweiz Rassismus gegen Schwarze (132 Fälle) neben dem generellen Motiv Ausländer- und Fremdenfeindlichkeit (145 Fälle) das meist genannte Diskriminierungsmotiv ist. Darauf folgt das Motiv der Muslimfeindlichkeit mit 55 Fällen. Auch der Rassismusbericht der GRA bestätigt diese Einschätzung: In der Mehrheit der von der GRA registrierten rassistischen Vorfälle wurden dunkelhäutige Menschen sowie Musliminnen und Muslime beschimpft, benachteiligt oder bedroht. Im letzten Jahr wurde ausserdem eine Zunahme rechtsextremer Vorfälle festgestellt, wobei es bis zu verbalen und physischen Übergriffen auf einen Schwarzen Jugendlichen gekommen ist.
Auch die Schweiz verzeichnet Fälle übermässiger Polizeigewalt an Menschen mit dunkler Hautfarbe. So sind zwischen 2016 und 2018 drei Fälle bekannt, in denen dunkelhäutige Personen den Folgen von unverhältnismässiger Polizeigewalt erlagen. Die Untersuchungen der Vorfälle sind derzeit noch am Laufen. Häufiger als übermässige Polizeigewalt sind jedoch Fälle von Racial Profiling (diskriminierende, verdachtsunabhängige Kontrolle durch Polizei, Bahnpolizei oder Grenzwachtkorps einzig oder primär aufgrund gruppenspezifischer Merkmale wie Hautfarbe, Sprache, Religion oder ethnischer Herkunft). Solche Kontrollen werden von den betroffenen Personen häufig als demütigend empfunden. Obwohl die Kantone Bern, Basel und Zürich bereits Massnahmen zur Überwachung von Racial Profiling durch die Polizei ergriffen haben, gibt es in der Schweiz noch zu wenig Unterstützung für Betroffene von Racial Profiling.
Rassismus tritt jedoch nicht nur in Form von Polizeigewalt oder Racial Profiling auf, sondern hat vielfältige, nicht minder verletzende Erscheinungsformen. Subtiler, unterschwelliger Rassismus schlummert im Alltag. So muss eine Person möglicherweise merken, dass sie wegen ihrer Hautfarbe oder wegen ihres «ausländisch» klingenden Namens Schwierigkeiten auf dem Arbeits- oder Wohnungsmarkt hat. Wie der Bericht der EKR aufzeigt, findet rassistische Diskriminierung am meisten in der Öffentlichkeit oder in der Arbeitswelt statt. Doch auch in der Schule, in der Nachbarschaft, im öffentlichen Verkehr, in der Freizeit oder in der öffentlichen Verwaltung findet sich struktureller und systemischer Rassismus wieder. So werden etwa Menschen wegen ihres Aussehens bei einem Behördenbesuch unfreundlicher und schlechter behandelt. Auch sehr subtile Formen von Rassismus sind verletzend, etwa wenn der Platz neben einem People of Color im Bus frei bleibt, obwohl alle anderen Plätze besetzt sind.
Für die GMS stellt jeder Angriff auf eine Minderheit auch ein Angriff auf die demokratischen Werte unserer Gesellschaft dar. Genauso wie in den USA gilt auch in der Schweiz, dass von Rassismus Betroffenen Menschen der Zugang zu Gerechtigkeit ermöglicht und erleichtert werden muss. Leider fehlen auch in der Schweiz immer noch stellenweise langfristige Strategien zur Umsetzung des Diskriminierungsschutzes. Es muss unbedingt in Ausbildung, Sensibilisierung und Prävention investiert werden. Wichtig ist, dass ein offener und sachlicher Dialog geführt und gefördert wird. Ein Beispiel für einen solchen Dialog ist etwa der Runde Tisch gegen Rassismus der Stadtpolizei Zürich, an dem die GMS und die GRA regelmässig teilnehmen. Am Runden Tisch werden unter anderem Lösungen für die Bekämpfung von Racial Profiling diskutiert und Begegnungsmöglichkeiten zwischen Interessensgruppen geschaffen.
Welchen Beitrag kann ich als Mitglied der Gesellschaft leisten, um Rassismus den Kampf anzusagen? Hier, einige Vorschläge:
- Betroffenen zuhören und Raum lassen
- Empathie zeigen
- Mich informieren
- Selbstreflexion: Eigenes Verhalten hinterfragen, eigene Vorurteile erkennen und abbauen. Verantwortungsvoll und aktiv entscheiden, wie mit Stereotypen umzugehen ist und was ich dagegen tun kann
Ansprechen, aufzeigen und verurteilen: Zivilcourage zeigen und vorbildlich handeln, besonders bei Alltagsrassismus. Zum Beispiel eine Aussage oder Reaktion hinterfragen und für Minderheiten (Mitmenschen!) einstehen.

Standpunkt der GMS zum Burkaverbot
In der Schweiz soll niemand in der Öffentlichkeit sein Gesicht verhüllen und niemand eine Person zwingen dürfen, ihr Gesicht aufgrund ihres Geschlechts zu verhüllen. Das fordert die Initiative «Ja zum Verhüllungsverbot», welche von SVP-nahen Kreisen eingereicht und vom Parlament und Bundesrat in der Sommersession zur Ablehnung empfohlen wurde. Darüber wird es bald eine Volksabstimmung geben.
Der Gegenvorschlag zur sogenannten Burka-Initiative sieht vor, dass alle, die sich im öffentlichen Verkehr oder bei Behörden identifizieren müssen, die gesetzliche Pflicht haben, das Gesicht zu zeigen. Er fand in beiden Räten eine Mehrheit, kommt als indirekter Gegenvorschlag aber nicht zur Abstimmung.
Das Egerkinger Komitee um den SVP-Nationalrat Walter Wobmann zielt mit der Burka-Initiative nach der Minarettverbotsinitiative zum zweiten Mal auf die muslimische Gemeinschaft in der Schweiz. Diesmal geschieht es im Namen der Geschlechtergleichheit. Denn die Burka wird, wenn überhaupt, ausschliesslich von muslimischen Frauen getragen. Es wird auf ein augenfälliges und mit viel Symbolik aufgeladenes Kleidungsstück gezielt, statt dass über die Hintergründe von Diskriminierung und Ausschluss aufgrund des Geschlechts oder der kulturellen und religiösen Herkunft gesprochen wird. Es wird eine Stellvertreterdebatte geführt, die sich gegen «den Islam» in unserer Gesellschaft richtet. Statt Integrationsschranken beim Zugang zu Bildung, Arbeit und politischen Rechten abzubauen, reden die InitiantInnen lieber von einer angeblichen Integrationsunwilligkeit und Integrationsunfähigkeit der muslimischen Bevölkerung. Sie orten das Problem im Islam, der mit unseren westlichen Werten inkompatibel sei. Es wird ein einseitiges und pauschales Bild eines patriarchalischen und frauenfeindlichen Islam gezeichnet, was gerade in der Schweiz so nicht der Realität entspricht.
Wenn es den Initianten wirklich um die Würde der Frau ginge, müsste es ihnen aber um die Würde aller Frauen in unserer Gesellschaft gehen. Sie haben sich aber nie für feministische Kampagnen gegen Sexismus in der Werbung, gegen die Pornografisierung von Frauenkörpern zu Werbezwecken oder für griffige Gesetze gegen den Frauenhandel stark gemacht. Pauschal von der Unterdrückung muslimischer Frauen auszugehen, wie dies das Egerkinger Komitee tut, ist Ausdruck eines Paternalismus, der den muslimischen Frauen keinerlei Handlungsmacht zuspricht. Zudem wird mit dem Burka-Verbot ein neues «Sondergesetz» für Musliminnen geschaffen.
Die GMS propagiert das Tragen einer Burka in keiner Weise, weil sie die Freiheit der Frauen einschränkt. Es ist für die GMS auch ganz klar, dass keine Frau zur Verhüllung gezwungen werden darf. Wenn aber eine Frau, die hier lebt, entscheidet, dass sie sich, aus welchen Motiven auch immer, verschleiern will, dann muss unsere freiheitliche Rechtsordnung das zulassen. Der Staat darf nicht das Tragen bestimmter Kleidungsstücke verbieten und damit in die persönliche Freiheit der Menschen eingreifen. Die Initiative fokussiert zudem auf ein Problem, das in der Schweiz kaum existiert, verstärkt aber die Vorurteile gegen muslimische Gruppen und fördert ein Klima der Intoleranz. Deshalb leiden religiöse Minderheiten oft an Ausgrenzung und Diskriminierung. Die umfassende Durchsetzung der Religionsfreiheit ist für alle gläubigen Menschen von grundlegender Bedeutung. Selbstverständlich aber müssen sich alle Religionen an der Respektierung der Menschen- und Frauenrechte messen lassen. Gerade was die Umsetzung der Frauenrechte anbelangt, sind die meisten Religionen schwer im Verzug.
Die GMS kämpft gegen die Instrumentalisierung von Frauenrechten als emotionale Mobilisierungsstrategie für eine fremdenfeindliche Politik. Wir unterstützen Massnahmen, die das Selbstbestimmungsrecht von Frauen im Allgemeinen und der Migrantinnen im Besonderen schützen und fördern, sowie die Diskriminierung von religiösen und anderen Minderheiten beheben. Da die Burka-Initiative all diesen Bemühungen zuwiderläuft, bekämpft sie die GMS, wie das alle anderen Schweizer Menschenrechtsorganisationen auch tun.

Die GMS engagiert sich im Trägerverein des Schweizer Memorials
Was ist das Schweizer Memorial für die Opfer des Nationalsozialismus?
Mit dem Schweizer Memorial wird den unterschiedlichsten Opfern des Nationalsozialismus gedenkt. Es versteht sich als Erinnerungsort, Vermittlungsort und Netzwerk in einem.
Seit der Bundesrat im April 2023 entschieden hat, einen Erinnerungsort mit 2,5 Millionen Franken zu errichten, haben, unter Federführung des Eidgenössische Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA), Vertreter:innen der Stadt Bern, des Schweizerisches Israelitischen Gemeindebunds (SIG) und des Archivs für Zeitgeschichte (AfZ) der ETH Zürich in Zusammenarbeit mit Fachpersonen intensiv am Projekt gearbeitet und dessen Strukturen aufgebaut und gefestigt.
Der Erinnerungsort ist heute auf der Casinoterrasse in Bern geplant, das «Vermittlungszentrum Flucht» in Diepoldsau.
Ein Trägerverein für das Schweizer Memorial
Seit 2025 gibt es neben des Netzwerkvereins auch den Trägerverein. Ihm obliegt die langfristige Verantwortung für den Erinnerungsort in Bern – insbesondere für dessen Betrieb, Pflege, Sicherheit und dessen Weiterentwicklung. Später kann der Trägerverein eine entsprechen Rolle für das geplante «Vermittlungszentrum Flucht» im St. Galler Rheintal übernehmen. Der Verein versteht sich als Bindeglied zwischen Zivilgesellschaft, Fachwelt und Behörden. Neben dem SIG und dem AfZ ist auch die GMS Mitgründerin des Trägervereins.
Die GMS engagiert sich für ein inklusives, zukunftsgerichtetes Gedenken und bringt ihre
Perspektive auf Minderheitenrechte und Erinnerungskultur ein.
Webseite des Schweizer Memorials
Medienmitteilung Wettbewerbslancierung