Neues aus der GMS

Rassismusbericht 2022
Analyse und Erläuterung zu Diskriminierungsfällen in der Schweiz
Der neuste Bericht der GRA und GMS ist da.
Besorgniserregend ist die Tatsache, dass die rechtsextremen Aufmärsche stark zugenommen haben. Auffällig ist auch der grosse Anteil verbaler Rassismusvorfälle im öffentlichen Raum. Struktureller und institutioneller Rassismus tritt besonders häufig auf, wie die Analyse der direkten Meldungen von Betroffenen an die Stiftungen zeigt.
Ein weiteres Thema, das letztes Jahr die Schweizer Medien dominierte und zu hitzigen und wenig konstruktiven Debatten führte, war die sogenannte kulturelle Aneignung. Zur Diskussion über linke Identitätspolitik haben wir Hintergrundinterviews mit der Kulturwissenschaftlerin Yebooa Ofosu und dem Politikwissenschaftler Oliver Strijbis geführt.
Der Rassismusbericht 2022 als PDF

Antisemitische Vorfälle haben auch im Jahr 2022 zugenommen
Es folgt eine Zusammenfassung des Antisemitismusberichts 2022 herausgegeben vom Schweizerisch Israelitischen Gemeindebund SIG und der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus GRA.
Die Zahl der erfassten antisemitischen Vorfälle hat auch 2022 zugenommen. Sowohl in der realen Welt wie auch Online sind Zunahmen ersichtlich.
Hauptverantwortlich für einen Grossteil der Vorfälle Online ist eine neue staats- und gesellschaftsfeindliche Subkultur.
In der Schweiz hat sich seit Beginn der Coronapandemie vor drei Jahren eine verschwörungsaffine Subkultur gebildet. Diese zeichnet heute für einen Grossteil der antisemitischen Vorfälle Online verantwortlich. Diese Subkultur und ihre Telegramgruppen verursachen mittlerweile 75 Prozent aller Onlinevorfälle. Sie ist damit hauptverantwortlich dafür, dass auch 2022 eine Steigerung bei den antisemitischen Vorfällen in der deutsch-, der italienisch- und der rätoromanischsprachigen Schweiz verzeichnet werden muss.
In diesem Umfeld werden zahlreiche Verschwörungstheorien verbreitet, vielfach zur Coronapandemie aber auch zu diversen anderen Themen. Der Ukrainekrieg hat hier für zusätzliche Elemente gesorgt. In ihrer Vorstellungswelt hängen alle diese Themen und die dazugehörigen Theorien zusammen und ergeben eine eigene Realität. Diese Subkultur erschafft sich damit eine Parallelwelt und unterstreicht dies, indem sich viele ihrer Mitglieder immer mehr von der Gesellschaft und den staatlichen Strukturen entfernen.
Im Vergleich zum Vorjahr wurde auch in der realen Welt eine Steigerung der Zahl antisemitischer Vorfälle von 53 auf 57 registriert. Erstmals seit 2018 wurde der Meldestelle des SIG eine Tätlichkeit gemeldet. Die Zahl der Beschimpfungen (16) blieb genau gleich hoch wie 2021. Bei den öffentlich getätigten Aussagen (6, -1), den Schmierereien (9, +2) und den Zusendungen (26, +3) kam es nur zu kleineren Verschiebungen. Dazu kamen noch jeweils ein antisemitischer Auftritt (-2) und ein antisemitisches Plakat (+1). 2022 wurden keine Sachbeschädigungen gemeldet.
Die Erkenntnisse dieses Berichts machen die entscheidende Bedeutung des Antisemitismusmonitorings deutlich. Der Bund sollte vermehrt die verschiedenen bestehenden Beobachtungs- und Analyseinstrumente von NGOs und Verbänden unterstützen und hier endlich Mitverantwortung übernehmen. Der Bund sollte auch rechtlichen Mittel zur Erfassung und Beschränkung von Hassrede prüfen. Die Politik muss ausserdem auf die Social-Media-Plattformen einwirken, die Verbreitung solcher Hassbotschaften zu unterbinden, insbesondere Telegram. Ganz generell braucht es eine nationale Strategie gegen Antisemitismus, die entsprechende Analyse-, Präventions- und Sanktionsinstrumente enthält. Dazu gehört auch das aktuell im Parlament behandelte Verbot von Nazisymbolen, das rasch umgesetzt werden muss.

Wie die Medien das Bild von Minderheiten prägen
Die Medien prägen massgeblich den gesellschaftlichen Diskurs und dabei auch das Image von bestimmten Minderheiten. Welche diskriminierenden Aspekte kann Medienberichterstattung aufweisen und wie entstehen diese problematischen Inhalte? Wer kommt in den Medien zu Wort und wer nicht? Verschiedene Studien sind diesen Fragen nachgegangen.
Medien können präventiv auf Stigmatisierungen und Diskriminierung von Minderheiten einwirken, diese aber auch fördern. So werden etwa (negative) Vorurteile über Minderheiten bewusst oder unbewusst durch verallgemeinernde und polemische Berichterstattung verbreitet. Solche «Skandalgeschichten» generieren zwar Klicks, sind jedoch sachlich meist wenig fundiert und wirken sich negativ auf das Image der betroffenen Gruppen aus.
Diskriminierende Aspekte in der Medienberichterstattung
Vorurteilhafte oder diskriminierende Berichterstattung kann unterschiedliche Aspekte aufweisen. Eine Studie der Akademie für Journalismus und Medien der Universität Neuenburg (AJM), die die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR) in Auftrag gegeben hat, identifiziert sechs verschiedene Kategorien: (1) Ein allgemein diskriminierender Blickwinkel, der verallgemeinert und Probleme, Straftaten oder andere negative Handlungen bestimmten Gruppen oder deren Mitgliedern zuordnet. (2) Punktuelle Verallgemeinerungen, wenn einzelne Passagen negative Zuordnungen begünstigen (z.B. wenn ein Autodieb mehrmals als «der Marokkaner» bezeichnet wird). (3) Unausgewogene, negative, falsche oder ungenaue Verwendung von Bezeichnungen, die Stereotype verstärken und diskriminierende Einstellungen fördern können (z.B. die Verwendung des Wortes «Clan», wenn von Rom:nja die Rede ist). (4) Eine unangebrachte Titelgestaltung, die absichtlich mit Stereotypen spielt, um die Aufmerksamkeit der Leserschaft zu gewinnen (z.B. das Zitat «Meidet sie im Ehebett und schlagt sie!» eines Imams als Schlagzeile). (5) Eingeschränkte Repräsentation der betroffenen Gruppen, indem sie kaum oder gar nicht zu Wort kommen. (6) Bewusste oder unbewusste Dekontextualisierung oder Fehler in Bezug auf bestimmte Fakten oder Statistiken, sodass damit diskriminierende Zuordnungen zu gewissen Gruppen entstehen.
Repräsentation von Minderheiten in den Medien
Besonders die eingeschränkte Repräsentation von betroffenen Gruppen wurde bereits vertieft analysiert. 2013 hat die EKR beim Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich (fög) eine Studie über die Qualität der Berichterstattung über Rom:nja und Jenische in Leitmedien in der Schweiz in Auftrag gegeben. Die Studie legt dar, dass ab 2010 besonders die Berichterstattung über Rom:nja zugenommen hat. Auffällig sind dabei die Differenzen zwischen Aus- und Inlandberichterstattung: Bei der Berichterstattung über Rom:nja im Ausland liegt der Fokus vor allem auf der Diskriminierung von Rom:nja und den Versuchen, dieser Diskriminierung entgegenzuwirken. Wenn über Rom:nja in der Schweiz berichtet wird, geht es hingegen grösstenteils um vermeintliche Probleme, die sich aus der Nicht-Sesshaftigkeit gewisser Rom:nja ergeben, um Kriminalität, Prostitution und Bettelei. Somit besteht hinsichtlich der Berichterstattung über Rom:nja in der Schweiz ein einseitiger Fokus auf negatives, abweichendes und kriminelles Handeln, der die Wahrnehmung von Rom:nja, Sinti:zze und Jenischen in der Schweiz stark prägt. Rom:nja, Sinti:zze und Jenische kommen selbst nur sehr selten zu Wort und wenn, dann nur als Reaktionen auf gewisse «Probleme». Sie vermögen jedoch nicht, eigene Themen in die Berichterstattung einzubringen. Die Hälfte der untersuchten Berichte verwendet Pauschalisierungen und ein Viertel auch negative Stereotypen.
Ein ähnliches Bild zeichnet eine weitere Studie des fög über die Qualität der Berichterstattung über Muslim:as in der Schweiz. Hier wird die Intensität der Berichterstattung vor allem durch Terroranschläge im europäischen Ausland und durch politische Kampagnen im Inland beeinflusst. Negative Themen wie «Radikalisierung» und «Terror» sind sehr stark verbreitet und sind oft mit Pauschalisierungen verknüpft. Positiv konnotierte Themen, wie «gelingende Integration» oder «Alltag», kommen hingegen praktisch gar nicht vor. Durch die negative Berichterstattung wird Distanz gegenüber den muslimischen Akteur:innen in der Schweiz geschaffen. Wie bei der Berichterstattung über Rom:nja, bleiben die betroffenen Muslim:as vor allem Berichterstattungsobjekte und kommen selbst kaum zu Wort. Wenn, dann sind es einzig polarisierende Stimmen. Auch die Studie des fög über die «Sichtbarkeit von Akteur:innen und ihrer Positionen in redaktionellen Medien und Twitter im Abstimmungskampf um das Verhüllungsverbot» zeigte, dass muslimische Akteur:innen weder in den Medien noch auf Twitter eine breite Resonanz fanden.
Ursachen für diskriminierende Medienberichterstattung
Der politische Diskurs hat einen grossen Einfluss auf die Medienberichterstattung. Bereits 2007 stellte eine Studie des fög über «Ausländer und ethnische Minderheiten in der Wahlkampfkommunikation» fest, dass die «Problematisierung des Fremden» ein zentrales Thema in Wahlkämpfen darstellt. Es werden in hohem Masse Typisierungen verwendet, die gegenüber Ausländer:innen und ethnischen Minderheiten Distanz erzeugen (z.B. «kriminelle Ausländer», «die Ausländer», «die Muslime»). Die Medien greifen diese Typisierungen auf, korrigieren die Problematisierung zwar teilweise, schreiben sie aber auch in der Berichterstattung fest. Ein Teil der Problematisierung des «Fremden» bleibt damit unwidersprochen.
Auch eine neue Studie der AJM untersuchte, wie Inhalte mit potenziell diskriminierenden Inhalten überhaupt (re)produziert werden. Bereits bei der Themenauswahl besteht die Tendenz, problematische Inhalte auszuwählen, da diese mehr Klicks bringen. Im Hinblick auf die Konkurrenz zwischen den verschiedenen Medien versuchen einige, sich zu positionieren, indem sie sich thematisch abgrenzen. Teilweise werden in Berichten Informationen aus Agenturmeldungen, polizeilichen Quellen oder Aussagen von Personen aus der Politik einschliesslich deren Haltungen wiedergegeben, ohne diese zu problematisieren. Auch bestimmte stilistische bzw. erzählerische Entscheidungen können Formulierungen fördern, die negative Vorurteile begünstigen. Nachrichten, die unter Zeitdruck entstehen, lassen häufig wichtige Kontextelemente aus (genaue Zahlen werden etwa nicht wiedergegeben), enthalten zum Teil problematische Begriffe und Formulierungen (z.B. rassistische Fremdbezeichnungen wie das «Z-Wort» für fahrende Gemeinschaften) und sind deshalb anfälliger für diskriminierende Vorurteile. Nicht zuletzt sind auch Formatvorlagen der Grund für fehlende Kontextualisierungen. Die befragten Journalist:innen gaben an, dass es häufig schwierige Entscheide seien, die sie treffen müssten, die auf widersprüchlichen Berufslogiken beruhten.
Medien müssen eine soziale Verantwortung wahrnehmen können
Aus finanziellem Druck setzen Medien vielfach auf polarisierende Themen und verzichten stattdessen auf eine sachliche und ausgewogene Berichterstattung. Diese ökonomische Ausrichtung der Medien steht im Widerspruch dazu, dass Medien auch gleichzeitig eine soziale Verantwortung wahrnehmen können. Unabhängig von Werbegeldern berichten zu können, ist nur möglich, wenn die Politik bereit ist, mehr Finanzierung für Medien zu sprechen. Darüber hinaus sollten Medien aber auch ihre Strukturen überdenken. Minderheiten müssen sowohl in die Berichterstattung (strukturell) als auch innerhalb der Redaktionen (institutionell) miteinbezogen werden. Vorbildlich haben einige Medien bereits sogenannte Social Responsibility Boards eingerichtet, die sich zum Beispiel mit Vorurteilen und potentieller Diskriminierung von Minderheiten auseinandersetzen. So kann eine vertrauensbasierte Zusammenarbeit geschaffen werden.

«Demokratie braucht Religion»
Die Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz (GMS) setzt sich für kulturelle, sprachliche und religiöse Minoritäten ein. Im Vorstand der GMS vertrete ich seit einigen Monaten die rätoromanische Sprachgemeinschaft. Daneben beschäftige ich mich seit vielen Jahren mit Religionen. In eine Engadiner Familie mit vielen Pfarrherren hineingeboren, führten mich meine Studien von der Theologie, über die Religionswissenschaft, mit Schwerpunkt Judentum, zur Psychologie schliesslich ins Pfarramt. Ich brauchte die Aussensicht auf Religionsgemeinschaften, um mich langsam wieder der Innensicht zu nähern.
Jetzt, als Pfarrerin in Zürich, bin ich täglich mit Vorurteilen konfrontiert, die religiöse Gemeinschaften und gläubige Menschen betreffen. Deshalb ist es mir ein Anliegen, auf ein spannendes Büchlein des Soziologen Hartmut Rosa hinzuweisen. Es heisst: «Demokratie braucht Religion». Laut Rosa ist unsere Gesellschaft zum Wachstum verdammt, weil sie sich nur noch dynamisch stabilisieren lässt. Wir befinden uns in einem rasenden Stillstand und begegnen der Welt zunehmend aggressiv. Demokratie aber lebt davon, so der Soziologe, dass Menschen aufeinander hören und miteinander in Resonanz treten. Besonders Religionsgemeinschaften verfügen über Erzählungen, Riten, Praktiken und Räume, in denen diese Kulturtechniken geübt werden können.
Der kurze Text von Rosa ist lesenswert. Er regt zum Nachdenken an, indem er die in unserer säkularen Gesellschaft verbreitete Meinung relativiert, Religion sei einzig etwas für engstirnige Ewiggestrige. Aus einer Aussensicht verteidigt Hartmut Rosa die religiöse Innensicht. So etwas liest man nicht oft. Allerdings ist der Text keine soziologische Studie im engeren Sinne, sondern ein Plädoyer.
Das Vorwort hat Gregor Gysi geschrieben. Gysi, der einräumt, nicht an Gott zu glauben, weist darauf hin, dass religiöse Ideen durchaus einen emanzipatorischen Gehalt haben können.
Die GMS macht sich stark für das Lebensrecht, die Kultur und die Integration von alten und neuen Minderheiten. Religiöse Gemeinschaften gehören in der Schweiz zu den neuen Minderheiten. Die Stärke einer Gesellschaft zeigt sich daran, wie die Mehrheit mit Minderheiten umgeht. Neben dem Engagement für das Rätoromanische möchte ich mich im Vorstand der GMS dafür einsetzen, dass Menschen mit religiösen Weltbildern Respekt entgegengebracht wird. Dazu gehört auch das Recht, Kritik zu äussern, wo immer sie angebracht ist und auf die Stärkung unserer vielfältigen Gesellschaft zielt.
Chatrina Gaudenz, lic. sc. rel und Pfarrerin, Zürich
Siehe Hartmut Rosa, «Demokratie braucht Religion», Kösel 2022

Kirche «von oben» und Kirche «von unten»
Der folgende Text erschien erstmals als Gastkommentar unter dem Titel «Kirche «von oben» und Kirche «von unten»» in der NZZ am 26. September 2022.
Gründet die Kirche auf bindende Bekenntnisse, oder ist sie eine Institution, die demokratisch verfasst sein soll und ihre Bekenntnisse jeweils neu aushandeln muss? Die christlichen Konfessionen halten unterschiedliche Antworten auf diese Frage bereit.
Die reformierte Landeskirche des Kantons Zürich versteht sich als Teil der weltweiten christlichen Kirche, die in verschiedenen katholischen, orthodoxen und protestantischen Ausprägungen existiert, welche unterschiedliche Bekenntnisse hervorgebracht haben. Die Zürcher reformierte Kirche kennt seit 1868 kein verbindliches Bekenntnis mehr. Dieser Entscheid verdankte sich der damaligen Überzeugung, dass die politische Glaubens- und Gewissensfreiheit auch in der Kirche gelten müsse.
Die Bekenntnisfreiheit basiert aber auch auf einer grundlegenden theologischen Überlegung: Die reformierten Kirchen gründen auf das Evangelium und nicht auf ein bestimmtes Bekenntnis. Aus diesem Grund sind reformierte Bekenntnisse grundsätzlich revidierbar. Sie haben sich an der Bibel zu messen, die allerdings viele Stimmen in sich vereint. Der biblische Kanon begründet, wie Ernst Käsemann es einmal festgehalten hat, nicht die Einheit der Kirche, sondern die Vielzahl der Konfessionen. Deshalb impliziert und ermöglicht die Bibel unterschiedliche Glaubensbezeugungen.
Freiheit zum Bekenntnis
Bekenntnisfreiheit in der reformierten Tradition heisst entsprechend auch nicht Freiheit vom Bekenntnis, sondern Freiheit zum Bekenntnis: Das reformierte Gesangbuch mit seinen liturgischen Texten enthält zum Beispiel ein nach einer indonesischen Vorlage gestaltetes Bekenntnis, das für die Lebendigkeit der Artikulation des christlichen Glaubens steht.
Dass die Bekenntnisfreiheit der Zürcher Kirche ein treibender Faktor von Kirchenaustritten gewesen sein soll, wie etwa der ehemalige Generalvikar des Bistums Chur, Martin Grichting, in einem Gastbeitrag vermutete (NZZ 13. 8. 22), ist religionssoziologisch nicht erweislich, im Gegenteil unwahrscheinlich: Sie war für viele Mitglieder in den letzten 150 Jahren vielmehr ein wichtiger Grund zu bleiben.
Es ist eine Eigenart, kein Fehler des Christentums, dass es in unterschiedlichen Ausprägungen existiert, auch jeweils innerhalb spezifischer Konfessionen. Innerkirchliche Pluralität ist keine Mangelerscheinung. Die Zürcher Kirche des 19. Jahrhunderts kannte die Gegenüberstellung von Liberalen und Positiven, die sich heute zu einem kontinuierlichen Spektrum unterschiedlicher Überzeugungen weiterentwickelt hat, die gegenseitig respektiert werden.
Für Reformierte ist die Kirche keine himmlisch legitimierte Institution, sondern eine irdische Diskursgemeinschaft von Menschen, die über die Zufälligkeit und die Endlichkeit ihrer Existenz im Horizont Gottes nachdenken.
Als Kirche «von unten» ist sie notwendigerweise demokratisch organisiert. Reformierte Kirchen unterscheiden zwischen Legislative (Kirchensynode) und Exekutive (Kirchenrat) und nehmen für sich nicht in Anspruch, bessere institutionelle Organisationsformen als der Staat zu kennen. Ihre Funktionsträgerinnen und -träger sind demokratisch gewählt und unterstehen Kirchengesetz und Kirchenordnung. Sie sind weder bessere noch schlechtere Menschen als ihre Mitglieder. Im Rahmen des «allgemeinen Priestertums aller Gläubigen» bewegen sich alle in gleicher Nähe und Distanz zu Gott.
Die Kirche weiss, dass sich das Wohl einer Gemeinschaft am Wohl ihrer Schwächsten bemisst, und sie setzt sich für diese ein. Die reformierte Kirche versteht sich als diakonische, nicht als bischöfliche Kirche und setzt auch hier einen besonderen Akzent auf das «von unten».
Die ökumenische Einheit der Kirchen
Bekenntnisse sind geschichtlich und geografisch bestimmte Artikulationen des Glaubens, die Identität nicht herstellen, sondern abbilden. Sie existieren nur in der Mehrzahl. Christlicher Glaube gründet auf der Pluralität menschlicher Lebenserfahrungen und Glaubensdeutungen.
Das Christentum hat deshalb verschiedene Konfessionen unterschiedlich ausgeformt, die Bekenntnisse oder eben auch Bekenntnisfreiheit kennen. Für die Ökumene bedeutet dies: Die Gemeinschaft der christlichen Kirchen ist pluralistisch strukturiert, und dies wird auch so bleiben. Ihre konfessionelle Vielfalt ist kein Skandal, sondern eine unhintergehbare Realität und ein inhaltlicher Gewinn. Die Gesamtkirche ist eine Kirche «von unten», und die reformierten Kirchen leben nach diesem Modell in Freiheit und mit Überzeugung.
Christoph Sigrist und Konrad Schmid
Christoph Sigrist ist Pfarrer des Grossmünster Zürich und GMS-Präsident. Konrad Schmid ist Professor für Altes Testament an der Universität Zürich.

Warum wir Gesichtserkennung in einer Demokratie nicht wollen können
Der folgende Text wurde von Angela Müller, Head of Policy & Advocacy bei AlgorithmWatch Schweiz, verfasst. Er erschien erstmals unter dem Titel «Gesichtserkennung im öffentlichen Raum gehört verboten» als Gastbeitrag in der NZZ am Sonntag vom 17. Juli 2022. Für die Veröffentlichung als GMS-Standpunkt wurde er an einigen Stellen leicht ergänzt.
Wenn der öffentliche Raum mit Hilfe von Gesichtserkennung oder anderen biometrischen Erkennungssystemen überwacht wird, ist das eine Gefahr für die Grundrechte. Und für die Demokratie.
In der Ukraine hilft eine Technologie zur Gesichtserkennung dabei, Vermisste zu suchen oder Tote zu identifizieren, wie der Vizeregierungschef kurz nach Kriegsbeginn bestätigte. Der Konzern Clearview.AI stellt dem Land das entsprechende System kostenlos zur Verfügung. Russland nutzt solche Technologien über den militärischen Kontext hinaus. In Moskau können nicht nur Metro-Tickets via Gesichtsscan bezahlt werden. Die fast 200 000 Überwachungskameras der Metropole dienen auch dazu, Demonstrierende bei Protesten, etwa zur Unterstützung des Oppositionellen Alexei Nawalny, zu identifizieren.
Russland und die Ukraine sind nicht allein. In ganz Europa werden heute biometrische Fern-Erkennungssysteme eingesetzt – auch im zivilen Kontext. Gemeint sind damit nicht Systeme zur Authentifizierung, mit denen wir etwa das Smartphone entsperren, sondern Systeme, die uns anhand unserer biometrischen Daten, wie dem Gesicht oder der Stimme, aus einer Masse heraus identifizieren können, indem sie auf eine Datenbank zurückgreifen. In der Schweiz werden diese Systeme von einigen Polizeikorps verwendet. Auch Fussballstadien und Supermärkte liebäugeln damit.
Auf den ersten Blick scheint dies ein Instrument zu sein, das wir für eine effizientere Strafverfolgung und für die Gewährleistung von Sicherheit nutzen sollten. Doch so einfach ist die Sache nicht. In den USA wurden etwa mehrere Menschen irrtümlich verhaftet, weil ein Gesichtserkennungssystem sie falsch identifiziert hatte. Oft handelt es sich dabei um dunkelhäutige Menschen. Deren Gesichter sind in den Trainingsdaten, mit denen die Systeme entwickelt wurden, oft untervertreten – mit der Folge, dass die Systeme dunkelhäutige Gesichter weniger gut erkennen. Dasselbe gilt für nicht-männliche Gesichter.
Eine Verbesserung der Technologie löst das Problem aber nicht. Denn unabhängig davon, wie gut oder schlecht sie funktioniert: Wenn sie im öffentlich zugänglichen Raum eingesetzt wird, wenn auf öffentlichen Plätzen, in Bahnhöfen, Stadien oder Einkaufszentren die Infrastruktur vorhanden ist, um Personen jederzeit automatisiert zu identifizieren, berührt das uns und unsere demokratische Öffentlichkeit im Kern. Es verletzt nicht nur unser aller Recht auf Privatsphäre, sondern kann uns auch davon abhalten, unsere Meinung zu äussern oder uns zu versammeln.
Das blosse Wissen, dass wir potenziell erkannt – und damit verfolgt und überwacht – werden könnten, wird unser Verhalten konditionieren: Es kann uns davon abschrecken, Orte oder Anlässe aufzusuchen, die Hinweise auf unsere politische Gesinnung, sexuelle Orientierung oder Religion geben könnten. Quellen könnten davor zurückweichen, Journalist:innen zu treffen, Mandatsträger:innen könnten auf private Treffen verzichten, Sans-Papiers den öffentlichen Raum gänzlich meiden. Ob in einer bestimmten Situation eine tatsächliche Überwachung erfolgt oder nicht, ist dafür nicht einmal entscheidend – da die Systeme aus der Ferne funktionieren, ist für uns nicht ersichtlich, wann und wo sie zum Einsatz kommen. Dazu kommt: Typischerweise sind bereits benachteiligte, von Diskriminierung betroffene Menschen und Angehörige von Minderheiten vermehrt Überwachungsmassnahmen ausgesetzt – etwa werden diese in Nachbarschaften mit einer hohen Verbrechensrate öfters eingesetzt. Deren Bewohner:innen wären entsprechend auch verstärkt von den Folgen biometrischer Überwachung betroffen. Dasselbe gilt für Menschen, die sich politisch exponieren.
Müssen wir diese Massnahmen allenfalls trotzdem in Kauf nehmen – im Interesse der öffentlichen Sicherheit? Die Gewährleistung von Sicherheit ist eine staatliche Kernaufgabe. Dem staatlichen Handeln sind allerdings Schranken gesetzt – aus guten Gründen. Es gäbe einige Mittel, welche die Strafverfolgung effizienter machen könnten – und die von autoritären Staaten auch gerne eingesetzt werden: Sie reichen von der Nutzung invasiver Technologien bis hin zur Folter. In einem liberalen Rechtsstaat ist jedoch der Orientierungspunkt klar: Es sind die verfassungsmässig geschützten Grundrechte, die uns zeigen, wo die Linie zu ziehen ist und welcher Mittel sich der Staat bedienen darf – und welcher eben nicht, weil sie mit unserer Freiheit, Autonomie und Würde nicht vereinbar sind. Im öffentlichen Raum schränken Gesichtserkennungssysteme unsere Grundrechte auf eine Weise ein, die nicht verhältnismässig ist – und berühren damit auch die Teilnahme am öffentlichen Leben und Diskurs, was für eine gesunde Demokratie unabdingbar ist.
Ein Verbot von biometrischen Systemen zur Identifikation im öffentlich zugänglichen Raum ist angezeigt. Vor diesem Hintergrund ist auch die Zivilgesellschaft aktiv geworden. Auf europäischer Ebene wirbt die Kampagne «Reclaim Your Face» für ein EU-weites Verbot, international fordern über 200 Organisationen ein globales Verbot. In der Schweiz haben die NGOs AlgorithmWatch Schweiz, Amnesty International und die Digitale Gesellschaft die Kampagne «Gesichtserkennung stoppen» lanciert, um ein Verbot von biometrischer Erkennung im öffentlich zugänglichen Raum zu erwirken. Eine erste Petition wurde von über 10 000 Personen unterzeichnet. Politiker:innen von links bis rechts haben den Handlungsbedarf erkannt und unterstützen die Kampagne. Seit ihrem Beginn wurden etwa in Zürich, Lausanne oder Basel Vorstösse für ein solches Verbot eingereicht, die auch bereits Wirkung zeigten: So will die Stadt Zürich biometrische Identifizierungssysteme für ihre Behörden verbieten.
Wollen wir alle, als Einzelpersonen und als Gesellschaft, von der Nutzung neuer Technologien profitieren, müssen wir gemeinsam Rahmenbedingungen dafür gestalten – und da rote Linien ziehen, wo die Technologie uns nicht mehr nützt, sondern schadet. Mit Gesichtserkennung im öffentlichen Raum würden Voraussetzungen geschaffen für etwas, was wir nicht wollen können – weder für uns selbst noch für unsere Demokratie.
Dr. iur. des. Angela Müller, Head of Policy & Advocacy, AlgorithmWatch Schweiz
Angela Müller leitet den Bereich Policy & Advocacy bei Algorithm Watch Schweiz, einer Non-Profit-Organisation, die sich mit den Auswirkungen algorithmischer Systeme auf Mensch und Gesellschaft beschäftigt und sich dafür einsetzt, dass deren Nutzung Grundrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit achtet. Sie hat politische Philosophie studiert und eine rechtswissenschaftliche Dissertation zum Thema Menschenrechte im Kontext von Globalisierung und neuen Technologien verfasst.

Jenische, Sinti und Roma in der Schweiz
Obwohl es sich bei Jenischen, Sinti:zze und Rom:nja um unterschiedliche ethnische Gruppen handelt, werden sie häufig in denselben Topf geworfen. Nach wie vor bestehen viele negative Vorurteile gegenüber diesen in der Schweiz lebenden Minderheiten. Dies stellt sie vor Schwierigkeiten im alltäglichen Leben und führt zu Diskriminierungen in verschiedenen Lebensbereichen.
In der Schweiz leben ca. 30’000 Jenische und einige hundert Sinti:zze. Nur etwa 2’000 – 3’000 davon pflegen eine fahrende bzw. halbnomadische Lebensweise. Die rund 50’000 in der Schweiz lebenden Rom:nja sind allesamt sesshaft. Alle drei Gruppen leben entweder schon immer oder seit sehr langer Zeit in der Schweiz. Im Sommer durchfahren auch ausländische fahrende Rom:nja das Land.
Jenische sind eine kulturelle Minderheit, die in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg einheimisch ist. Die eigene Sprache, das Jenische, lehnt an die jeweiligen Regionalsprachen an und bedient sich Ausdrücken aus dem Romanés, dem Jiddischen und dem Rotwelschen. Von den ca. 30’000 Jenischen in der Schweiz pflegen nur etwa 2’000-3’000 eine halbnomadische Lebensweise.
Sinti:zze leben vor allem in Deutschland und Österreich. In der Schweiz leben nur wenige Sinti:zze und sie werden häufig mit den Jenischen in Verbindung gebracht. Sie nennen sich in der Deutschschweiz auch «Manische», ein Ausdruck, der von der französischen Bezeichnung «Manouches» kommt. Die Manouches sind hauptsächlich in Frankreich ansässig. Weder die Jenischen, Sinti:zze oder Manouches verstehen sich zumindest in der Schweiz nicht als Rom:nja.
Der Bundesrat hat die Jenischen, die Sinti:zze und Manouches als nationale Minderheiten im Sinne des Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten des Europarats anerkannt. Auch die Rom:nja fordern eine solche Anerkennung. Die GMS ist der Ansicht, dass der Bundesrat dieser Forderung nachkommen sollte. Einerseits hätte dies einen bedeutungsvollen symbolischen Wert, andererseits würde den Rom:nja durch das Rahmenabkommen zudem einen grösseren Schutz sowie die Möglichkeit gewährt, ihre eigene Kultur öffentlich und ohne Angst zu leben.
Die Rom:nja sind eine eigenständige ethnische Gruppierung, die sich aus zahlreichen Bevölkerungsgruppen mit gemeinsamer indischer Herkunft und Sprache zusammensetzt. Die meisten und grössten dieser Gruppen leben in Rumänien, Ungarn, der Slowakei und Bulgarien. Auch dort sind die Gruppierungen wiederum in eine Vielzahl von Teilgruppen unterteilt. Der Europarat, die EU, die UNO und weitere internationale Organisationen verwenden die Bezeichnung «Roma» als Sammelbegriff, der alle Gruppen ohne festes eigenes Territorium einschliesst. Dieser Sammelbegriff hat sich etwa auch in den Medien etabliert. In Deutschland und Österreich wird offiziell die Bezeichnung «Roma und Sinti» verwendet. Die in der Schweiz lebenden Rom:nja sind mehrheitlich zwischen 1960 und 1990 eingewandert. Grösstenteils waren sie schon immer sesshaft und sind es auch heute noch. Fahrende Schweizer Rom:nja gibt es kaum. Die Rom:nja, die eine fahrende Lebensweise pflegen und die Schweiz vor allem in den Sommermonaten durchfahren, sind hauptsächlich aus den Nachbarländern, zum Beispiel aus Frankreich.
Auch heutzutage halten sich über Jenische, Sinti:zze/Manouches und Rom:nja immer noch viele hartnäckige negative Vorurteile. Diese Minderheiten werden etwa pauschal als «Zigeuner» bezeichnet und in der medialen Berichterstattung mit Armut, (Banden-)Kriminalität und Bettelei in Zusammenhang gebracht. Es gibt sogar Gemeinden, die vor angeblichen Betrugsgeschäften durch Fahrende warnen. Solche Stereotype führen regelmässig zu Diskriminierung und Benachteiligungen von – besonders fahrenden – Jenischen, Sinti:zze/Manouches und Rom:nja. So wird ihnen beispielsweise der Zugang zu Campingplätzen verwehrt, sie werden von der Polizei unverhältnismässig oft kontrolliert oder von den Behörden ungleich behandelt, etwa bei der Anmeldung in einer Gemeinde. Diese Erfahrungen– landläufig als «Antiziganismus» (d.h. Rassismus gegen Rom:nja, Sinti:zze/Manouches und Jenische) bezeichnet – haben massive negative Auswirkungen auf Bildung und die allg. Lebenssituation der betroffenen Familien. Darüber hinaus wird von gewissen politischen Parteien immer wieder politische Hetze gegen fahrende Gemeinschaften betrieben, um so die Errichtung von Halteplätzen zu verhindern. Dies, obwohl in der Schweiz bereits seit langer Zeit ein enormer Mangel an Halteplätzen für Fahrende Gemeinschaften und somit dringender Handlungsbedarf besteht (vgl. GMS-Standpunkt vom 31. Mai 2021).
Massnahmen aus der Vergangenheit, etwa das Projekt «Kinder der Landstrasse», welches systematisch Kinder aus fahrenden Familien entriss, führten zu diskriminierenden und traumatisierenden Situationen in der Jugend, die wiederum komplexe Probleme psychischer und finanzieller Art zur Folge hatten. So waren die betroffenen Personen und Familien oft nicht sozial und ökonomisch autark, und der Zugang zu Bildung für fahrende Kinder war erschwert. Wegen solchen Massnahmen sind Jenische und Sinti:zze/Manouches heute überproportional von Sozialhilfe abhängig. Das Bundesgericht hat immerhin entschieden, dass sich Fahrende beim Entscheid über eine IV-Rente nicht dieselben Arbeitsmöglichkeiten anrechnen lassen müssen, wie sesshafte Personen, weil ihr fahrender Lebensstil berücksichtigt werden müsse.
Die GMS setzt sich dafür ein, dass Vorurteile gegenüber Jenischen, Sinti:zze/Manouches und Rom:nja, insbesondere gegenüber den fahrenden Gruppierungen, weiter abgebaut werden. Nur so können Diskriminierungen und Benachteiligungen bekämpft werden. Und nicht zuletzt müssen für fahrende Gemeinschaften genügend Halteplätze zur Verfügung gestellt werden, die ihnen einen würdigen Lebensstil ermöglichen.
Links
Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende
Themendossier und Factsheet über Jenische, Sinti/Manouches und Roma der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus (EKR)

SAVE THE DATE: «Wer ist hier eine Minderheit?»
«Wer ist hier eine Minderheit? Zu Fragen von Mehrfachidentitäten, Intersektionalität und Repräsentation»
Die GMS ist Gastgeberin eines Inputvortrages von Hannan Salamat, Fachleitung Islam ZIID.
Anschliessend findet eine Podiumsdiskussion mit Hannan Salamat und Dina Wyler, ehemalige Geschäftsleiterin GRA, Moderation a.NR. und GMS Vizepräsidentin Cécile Bühlmann statt.
Danach lädt die GMS zum Apéro ein.
Der Eintritt ist kostenfrei.

Eine Karte für den Schutz der Schwächsten
Ich erinnere mich an die Besetzung der Predigerkirche in der Stadt Zürich durch über hundert Menschen. Auf ihren Manifesten stand «Bleiberecht». Das war im Jahr 2008. Erstmals fielen mir Sans-Papiers im Stadtbild auf, und ich freute mich darüber. Die mutige Aktion hat etwas in Bewegung gesetzt. Seither gibt es die Autonome Schule Zürichs, welche Sprachkurse für Immigrierte anbietet und auch von den Stadtbehörden respektiert wird. Sie leistet einen echten Beitrag zur Integration: 500 Schüler:innen lernen hier wöchentlich. Einer der damaligen Besetzer ist heute aktives Vorstandsmitglied der Gesellschaft Minderheiten Schweiz, gehört als einer, der sich nicht mehr verstecken muss, zur Wohnbevölkerung und ist eine prominente Stimme in der städtischen Vielfalt.
Arbeitskräfte ohne Rechte
Sans-Papiers leben versteckt und oft unter widrigsten Umständen. Erfahren sie Gewalt, können sie sich nicht juristisch wehren. Denn sie können nicht zur Polizei gehen, weil die Gefahr besteht, ausgewiesen zu werden. Ihr Aufenthaltsstatus würde geprüft. Sans-Papiers bewegen sich auf der Strasse in Angst vor polizeilichen Kontrollen. Viele für die Gesamtbevölkerung normale Dienstleistungen können sie nicht in Anspruch nehmen. Sie können keinen Mietvertrag abschliessen und kein Bankkonto eröffnen. Auch eine medizinische Behandlung ist mit der Angst verbunden, entdeckt zu werden. Zum Glück gibt es heute die Möglichkeit, dass Sans-Papiers, gedeckt durch die Anlaufstelle SPAZ, Spitäler besuchen können, ohne aufzufliegen. Eine Behelfslösung, aber immerhin.
Das Einfachste wäre, dafür zu sorgen, dass es keine Sans-Papiers mehr gibt. Sie legalisieren. Ihnen ein Aufenthaltsrecht geben. Das Bundesrecht verbietet das. Das Ausländer- und Integrationsgesetz sieht vor, dass rechtswidrig anwesende Migrant:innen die Schweiz verlassen müssen, ausser bei «schwerwiegenden persönlichen Härtefällen».
Das ist nicht nur unwürdig, es erinnert an den spätmittelalterlichen Zustand der «Hintersassen» ohne politische Rechte. Sans-Papiers gehören nämlich zur ständigen Wohnbevölkerung. Sie werden gebraucht in der privaten Care-Arbeit, in den Putzdiensten, auf Bauernhöfen. Systemrelevante Branchen wie Kinderbetreuung oder Pflegedienste würden ohne sie zusammenbrechen. Der Stadtrat von Zürich schätzt ihre Zahl auf rund 10 000.
Es gibt Sans-Papiers, die mehr als ein Dutzend Jahre in der Schweiz leben, hier Kinder aufziehen (die dann ebenfalls keine Ausweise haben) und sich durchschlagen. Wir können uns dieses Leben nicht vorstellen.
Die Zeit der Bürger:innen minderen Rechts und der Ansässigen oder Stadtburger gehört ins Mittelalter, es gibt kein Vorrecht der Geburt. Wer zur ständigen Wohnbevölkerung gehört, soll die gleichen Rechte haben. Die Aufgabe gleicht der Beseitigung der Hintersassen-Diskriminierung in der frühen Neuzeit.
City Card: Ja sagen und Druck ausüben
Die bestehenden Gesetze sollen respektiert werden, aber wir dürfen uns bemühen, sie zu verändern. Und wir müssen Möglichkeiten suchen, um das Leben von Sans-Papiers erträglicher zu machen. Die City Card kann eine solche Möglichkeit sein. Über sie wird am 15. Mai in der Stadt Zürich abgestimmt. Die City Card geht auf eine Motion von AL, Grünen und SP im Zürcher Gemeinderat zurück.
Die Vorlage des Stadtrates ist noch kein ausgearbeitetes Projekt. Der Stadtrat will einen Kredit für «Vorbereitungsarbeiten zur Einführung der City Card». Das ist etwas vage und der Preis mit 3,2 Millionen Franken etwas hoch. Umso mehr müssen wir zum Ausdruck bringen, dass wir eine City Card wollen und Druck ausüben, was für eine City Card das sein soll. Das Produkt wird auch ein Resultat der politischen Auseinandersetzung sein. Die Zielvorstellung des Autors, der jahrelang Vorstandsmitglied der Gesellschaft Minderheiten war, sieht so aus:
Die Züri City Card verschafft Sans-Papiers Zugang zu Hilfsangeboten, erleichtert ihren Alltag und ermöglicht ihnen ein weniger von Angst geprägtes Leben. Auch wenn die ausländerrechtlichen Vorschriften bestehen bleiben.
Dank der Züri City Card können Sans-Papiers ihre eigene Post abholen, ihre Kinder in Kitas anmelden, Bibliotheken besuchen und öffentliche Dienstleistungen nutzen.
Die City-Card nützt ihnen aber auch als Ausweis gegenüber der Stadtpolizei: Sans-Papiers werden bei Routine-Ausweispräsentationen bei der Stadtpolizei – Unfallzeugnis, Anzeigeerstattungen, Strassenkontrollen – nicht behelligt, wenn sie sich mit einer City Card ausweisen können. Sans-Papiers können die City Card im einfachen Verkehr mit Behörden gleich benutzen wie Personen mit Aufenthaltserlaubnis. So verwendet, verstösst die City Card auch nicht gegen übergeordnetes Recht, das haben die juristischen Abklärungen durch ein Rechtsgutachten der Universität Zürich ergeben.
Darüber hinaus wird die City Card als Ausweis für tout Zurich dienen, für alle. Dies im einfachen Verkehr mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen für Auskünfte bei städtischen Stellen, Beratungsangebote, Zugang zu Kindertagesstätten und Prämienverbilligungen, Zugang zu städtischen Stipendien, Abonnements der Verkehrsbetriebe, Anmeldung bei Spitälern, Einschreibung in Bibliotheken.
Wenn alle Zürcher:innen die Züri City Card erhalten und nutzen, ist das gleich noch einmal ein Schutz für die Schwächsten: Das Tragen einer Züri City Card lässt so keinen Rückschluss auf den Status einer Sans-Papier-Person zu.
Unterstützen wir die City Card und helfen wir, sie in die richtige Richtung zu entwickeln: als Karte, die die Schwächsten schützt. Als Karte der Einwohnenden, die solidarisch eine Community bilden wollen.
Willi Wottreng, Publizist
Vorstandsmitglied der Gesellschaft Minderheiten von 2000–2017
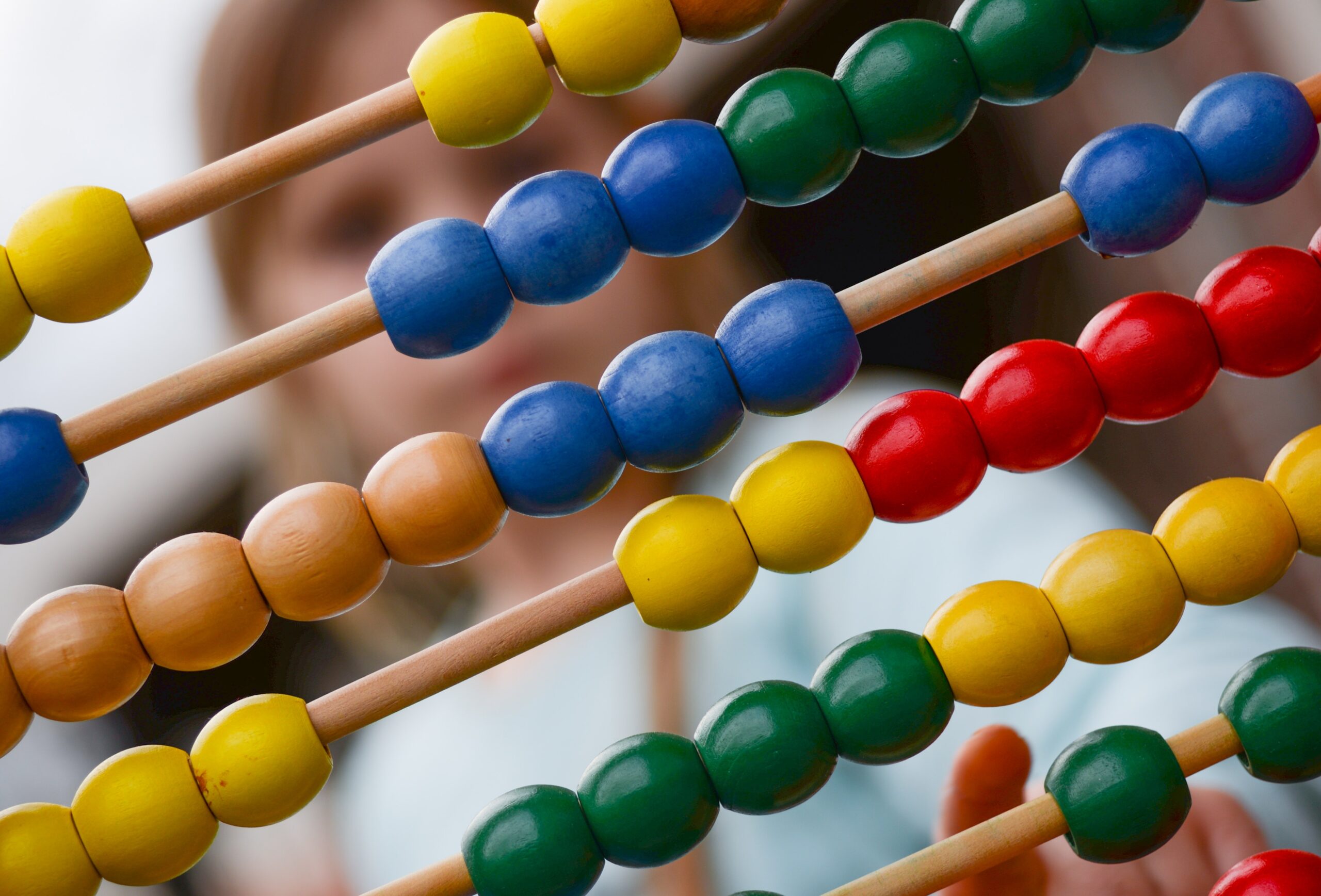
3 + ½ = 3: Die besondere Arithmetik der Schweizerischen Sprachpolitik
Welchen bedeutenden Entscheid für das Rätoromanische fällte das Schweizerische Stimmvolk 1938? Und weshalb ergibt seit 1996 in der Sprachpolitik 3 + ½ in den meisten Fällen 3? Eine kleine Tour d’Horizon rund um die oft vergessene und dabei schweizerischste aller Landessprachen.
Am 20. Februar 1938 fällte das Schweizer Stimmvolk einen für die rätoromanische Sprache denkwürdigen Entscheid. Es erhob das Rätoromanische mit 91,6% Ja-Stimmen zur Nationalsprache. Es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass die hohe Zustimmung nicht nur sprachpolitische Beweggründe hatte. Im Zuge der geistigen Landesverteidigung vor dem Zweiten Weltkrieg war der Entscheid auch eine dezidierte Absage an nationalistische Tendenzen Italiens, das eine Angliederung rätoromanisch- und italienischsprachiger Gebiete der Schweiz im Sinn hatte. Bis heute geblieben ist die bedeutende Verankerung des Rätoromanischen in Artikel 4 der Bundesverfassung: Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Happy End? Fast. Wäre da nicht die Crux mit der Unterscheidung zwischen Landessprache und Amtssprache. Knapp 60 Jahre nach der Volksabstimmung von 1938 doppelte Helvetia nach: Am 10. März 1996 wurde eine Revision des Sprachenartikels in der Bundesverfassung mit 76% Ja-Stimmen angenommen. Dieser Entscheid verleiht dem Rätoromanischen den Status einer Teilamtssprache des Bundes. Der Sprachenartikel in der Bundesverfassung hält fest, dass «im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache auch das Rätoromanische Amtssprache des Bundes» ist. Die weiteren Amtssprachen des Bundes sind Deutsch, Französisch und Italienisch.
Landessprache ohne Podestplatz
Eine integrale Bereitstellung der gesamten schriftlichen Kommunikation des Bundes auf Rätoromanisch wäre unrealistisch und zudem nicht sinnvoll. Rätoromanisch ist zwar Landessprache, jedoch nur Teilamtssprache des Bundes, sozusagen eine halbe Amtssprache. Texte von besonderer Tragweite sowie die Unterlagen für eidgenössische Wahlen und Abstimmungen sollen gemäss Sprachengesetz auch in Rätoromanisch veröffentlicht werden. Und nicht zu vergessen sind die Texte «im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache». Ein Beispiel: Eine Bürgerin schreibt einen Brief auf Rätoromanisch an die Bundesverwaltung. Der Fall ist klar, die Antwort erfolgt auf Rätoromanisch. Bravo! Zweites Beispiel: Das Bundesamt für Gesundheit lanciert eine grosse schweizweite Kampagne gegen die Ausbreitung des Coronavirus, verfasst in allen … – Falsch! Es brauchte politischen Druck, um die Herausgabe von wesentlichen Informationen der Corona-Kampagne auf Rätoromanisch zu erwirken. Der Grundsatz scheint zu sein, dass alles in den drei vollwertigen Amtssprachen herausgegeben wird und erstmal explizit nicht in der Teilamtssprache. Im Grunde ist es eine arithmetische Frage. Den Rechenfehler, den der Bund bei der Interpretation der ½ Amtssprache Rätoromanisch begeht, ist, dass er den Faktor 0.5 in fast allen Fällen abrundet. In der Konsequenz ergibt dies das omnipräsente Bild der dreisprachigen Schweiz. Internetseiten, Publikationen und Beschriftungen werden in Deutsch, Französisch und Italienisch verfasst. Das Rätoromanische gerät zunehmend in Vergessenheit. Es braucht ein Umdenken. Die Landessprache auf dem undankbaren vierten Platz hätte zumindest eine lederne Medaille verdient. Wie könnte ein sinnvoller Umgang mit der ½ Amtssprache aussehen? Der Bund sowie öffentliche Dienstleister, z.B. Post und SBB, die national agieren, müssten Rätoromanisch gesamtschweizerisch konsequent bei Beschriftungen aller Art verwenden. Dies dort, wo die anderen drei Amtssprachen der Schweiz aufgeführt werden. Im rätoromanischen Sprachgebiet muss die Sprache prioritär für Informationen an die Bevölkerung eingesetzt werden.
Bedroht trotz guter Rechtsstellung
Laut einem im Jahr 2019 erschienenen Evaluationsbericht im Auftrag des Bundes besteht für das Rätoromanische bereits mittelfristig die Gefahr einer existenziellen Bedrohung. Der Bericht empfiehlt u.a. eine vermehrte Förderung des Rätoromanischen ausserhalb des traditionellen Verbreitungsgebiets der Sprache, insbesondere die Bereitstellung von Bildungsangeboten auch ausserhalb des Kantons Graubünden. Im Rahmen der Kulturbotschaft 2021-24 wendet der Bund insgesamt rund 21 Mio. für das Rätoromanische auf. Erstmals entrichtet der Bund in dieser Periode Beiträge in der Höhe von 1,2 Mio. für Fördermassnahmen ausserhalb des angestammten Sprachgebiets. Ein Vorhaben verdeutlicht sinnbildlich die grossen Anstrengungen, das Rätoromanische auch an die nächste Generation weiterzugeben. Mit einem neuen online zugänglichen Bildungsangebot, genannt «Rumantsch a distanza» (Rätoromanisch im Fernunterricht), sollen Jugendliche auch ausserhalb des rätoromanischen Sprachgebiets ab dem Schuljahr 2023/24 die Sprache erlernen können. Aber wird die Förderung fruchten, wenn das Rätoromanische nirgends auf der Sprachlandkarte der Schweizer Bevölkerung erscheint? Präsenz im Alltag ist der Schlüssel: Der Bund sowie öffentliche Dienstleister auf nationaler Ebene sind gefordert und aufgefordert, nachzuziehen. Und dann ist auch klar, was die sprachpolitisch-arithmetische Gleichung 3 + ½ in der viersprachigen Schweiz ergibt. Auf jeden Fall mehr als 3.
Rumantsch – fünf Idiome, eine Sprache
Das Rätoromanische gliedert sich in fünf verschriftlichte Idiome (Sursilvan, Sutsilvan, Surmiran, Puter und Vallader) und verfügt über eine Standardschriftsprache, das Rumantsch Grischun. Rund 60’000 Personen in der Schweiz sprechen die Sprache. Ein Drittel der Romanischsprachigen lebt ausserhalb des Kantons Graubünden. In Gemeinden im rätoromanischen Sprachgebiet ist Rätoromanisch Amts- und Schulsprache. Im Kanton Graubünden sind Rätoromanisch, Deutsch und Italienisch die drei gleichwertigen Landes- und Amtssprachen.
von Andreas Gabriel, Stellvertretender Generalsekretär der Lia Rumantscha
Die Lia Rumantscha ist die Dachorganisation der rätoromanischen Sprachförderung. Im Auftrag des Bundes und des Kantons Graubünden vertritt sie die Interessen des Rätoromanischen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens.

Rassismusbericht 2021 online!
21.03.2022
Der neue Rassismusbericht der GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus und der GMS Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz thematisiert anlässlich des Internationalen Tages gegen Rassismus rassistische Vorfälle des vergangenen Jahres. 2021 kam es zu besonders vielen Sachbeschädigungen und Sprayereien mit nationalsozialistischen Symbolen im öffentlichen Raum. Auch im Zusammenhang mit Protesten gegen die Coronamassnahmen tauchten vermehrt Hakenkreuze oder gelbe Davidsterne auf, welche einen Vergleich zwischen der aktuellen politischen Situation und dem nationalsozialistischen Regime zu ziehen versuchen.
Rassismusbericht 2021 als PDF herunterladen
1. Vorwort
Das Jahr 2021 war geprägt von besonders vielen Sachbeschädigungen und Sprayereien mit nationalsozialistischen Symbolen im öffentlichen Raum. Als einer der gravierendsten Vorfälle gilt die im Februar 2021 verunstaltete Eingangstür zur Bieler Synagoge, welche mit einem Hakenkreuz und nationalsozialistischen Slogans beschmiert wurde. Im März ritzte ein unbekannter Mann ein Hakenkreuz in einen Baum am Zürcher Bellevue und im Sommer sprayten Unbekannte in Thalwil den Schriftzug «Impfen macht frei» mitsamt Hakenkreuz an eine Wand entlang der Zürcherstrasse. Ein weiterer Vorfall ereignete sich in einem Park im Tessin, wo ein Hakenkreuz an einem Schild angebracht wurde. Doch nicht nur die «klassischen» Symbole des Nationalsozialismus wurden im vergangenen Jahr im öffentlichen Raum gesichtet. Im Juli entrollten Jugendliche ein Banner an der Berner Kornhausbrücke, darauf die sogenannte Tyr-Rune, ein nach oben gerichteter Pfeil. Das Symbol steht für die Gruppierung «Junge Tat», die sich selbst als Jugendflügel der rechtsextremen Nationalen Aktionsfront (NAF) bezeichnet.
Der GRA gemeldeter Vorfall: ein auf den Nationalsozialismus verweisendes Symbol an der Heckscheibe eines Pickups
Letztlich tauchen im Zusammenhang mit Protesten gegen die Coronamassnahmen immer wieder Hakenkreuze oder gelbe Davidsterne auf, welche einen Vergleich zwischen der aktuellen politischen Situation und dem nationalsozialistischen Regime zu ziehen versuchen. Auch wenn nicht jeder dieser Vorfälle per se auf ein antisemitisches Motiv hindeutet, sind sie in ihrer Gesamtzahl doch bedenklich, da sie auf ein verwässertes Geschichtsverständnis innerhalb der Bevölkerung hindeuten und zu einer Verharmlosung der Gräueltaten dieser Zeit führen. Angesichts dieser Entwicklungen wurden Ende letzten Jahres gleich drei parlamentarische Vorstösse eingereicht, welche ein Verbot extremistischer oder nationalsozialistischer Symbole fordern. Zum Vorstoss von Marianne Binder-Keller, eine Forderung eines ausnahmslosen Verbots öffentlicher Zurschaustellung von Nazisymbolik, hat der Bundesrat bereits Stellung bezogen und argumentierte hierbei ähnlich, wie in früheren Stellungnahmen zu Vorstössen dieser Art. In seiner Begründung schreibt der Bundesrat, dass gegen die Verwendung von nationalsozialistischen Symbolen ohne Propagandazwecke Prävention ein besser geeigneteres Mittel sei als eine strafrechtliche Repression. Die GRA ist hier anderer Ansicht, denn das eine muss das andere nicht ausschliessen. Es braucht beides – Prävention, aber auch ein Verbot inklusive klarer Strafbestimmung. Daher hat die GRA eine Petition an den National- und Ständerat lanciert, welche bereits von Tausenden unterzeichnet wurde. Mit dieser Petition werden die Mitglieder des National- und Ständerats dazu aufgefordert, die eingereichten politischen Vorstösse anzunehmen und damit ein unmissverständliches Zeichen gegen Rassismus und Antisemitismus zu setzen (Mehr Informationen zu den politischen Vorstössen unter «Aktuelle Vorstösse zum Verbot von rassistischen Symbolen im Parlament»).
«Rassistische Symbole und Gesten vermitteln in komprimierter Form Aussagen, welche mit dem Kerngedanken einer demokratischen Gesellschaft nicht zu vereinbaren sind.»
Fest steht, dass Symbole eine nicht zu unterschätzende Wirkung haben und oftmals eine unmissverständliche Message vermitteln. Denn
Rassistische Symbole und Gesten vermitteln in komprimierter Form Aussagen, welche mit dem Kerngedanken einer demokratischen Gesellschaft nicht zu vereinbaren sind. Eine präzise Ausgestaltung und Formulierung der Strafnorm sind deshalb wichtig, um die öffentliche Verwendung von rassistischen Symbolen und Gesten genügend strafrechtlich zu erfassen. Zur aktuellen rechtlichen Lage und politischen Diskussion, um ein mögliches Verbot von nationalsozialistischen Symbolen im öffentlichen Raum, äussert sich nachfolgend Strafrechtsprofessor und Ständerat Prof. Dr. iur. Daniel Jositsch. Im zweiten Interview erläutert der Extremismusexperte Samuel Althof die Macht und Wirkung von Symbolen und ihrer Reichweite, insbesondere im Zusammenhang mit derzeit kursierenden Verschwörungsmythen.
Das vergangene Jahr war zudem weiterhin geprägt von antisemitischen Verschwörungsideologien. Aus diesem Grund hat die GRA einen neuen Informationsflyer für Lehrpersonen lanciert und auf ihrer Webseite ein Online-Glossar mit Codewörtern und Begriffen erstellt, welches über die Hintergründe der Verschwörungsideologien aufklärt und für die Inhalte sensibilisiert.
Im Vergleich zum Vorjahr erhielt die GRA vermehrt Meldungen über rassistische Vorfälle an Schulen. Neben rassistischen Äusserungen waren es vordergründig nationalsozialistische Symbole und Gesten, die gemeldet wurden (mehr dazu unter «Rassismus an Schulen»). Die GRA beobachtet diese Entwicklungen genau und hat ihre Bildungs- und Präventionsarbeit weiter ausgebaut, um Lehrpersonen, Lernende und Eltern bei einem konstruktiven Austausch zum Thema Rassismus und Antisemitismus zu unterstützen.
2. Rassismus in der Schweiz 2021
Die Chronologie der rassistischen Vorfälle, welche die GRA zusammen mit der Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz (GMS) auf der GRA Website unter www.gra.ch/chronologie fortlaufend führt, registrierte im Jahr 2021 insgesamt 86 rassistische oder antisemitische Vorfälle, die schweizweit von den Medien publiziert wurden.
Da nur die in den Medien publizierten rassistischen oder antisemitischen Vorfälle in die Chronologie aufgenommen werden, erhebt diese keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Chronologie beinhaltet auch nicht die direkt an die GRA gemeldeten Vorfälle (mehr dazu unter «Rassistische Meldungen»).
«Trotz der gestiegenen Anzahl erfasster Vorfälle, kann weiterhin von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden.»
Im Vergleich zum Vorjahr weist die Chronologie des Jahres 2021 einen Zuwachs an rassistischen Vorfällen auf. Ein Grund für die Zunahme der Vorfälle liegt in der anhaltenden COVID-19 Pandemie und den damit einhergehenden Massnahmenprotesten und öffentlichen Äusserungen von Massnahmen- und Impfgegner:innen. In diesem Zusammenhang gab es eine deutliche Zunahme an holocaustrelativierenden Vorfällen. Auch wenn diese Vorfälle nicht per se antisemitisch waren, verwässern sie in ihrer Gesamtheit das Geschichtsverständnis und sind daher alles andere als harmlos. Eine Zunahme von Vorfällen gab es ebenfalls bei Sachbeschädigungen und Schmierereien, wobei nationalsozialistische Symbole, wie das Hakenkreuz, sich besonders häuften. Beidiesen Vorfällen gab es in den meisten Fällen keinen direkten oder lokalen Bezug zu jüdischen Institutionen oder Personen.
Mehrere Parlamentarier:innen haben sich im letzten Jahr dieser Problematik angenommen und Vorstösse eingereicht, welche sich um ein Verbot rassistischer und antisemitischer Symbole im öffentlichen Raum bemüht. Die Antwort des Bundesrats steht noch aus und die Debatte im Parlament wird in den kommenden Wochen und Monaten geführt.
Ein weiterer Grund für die Zunahme von Fällen sind zahlreiche Meldungen über diskriminierende Vorfälle gegenüber Mitgliedern der LGBTQIA+ Community. Neben Beschimpfungen kam es vereinzelt auch zu tätlichen Angriffen.
Trotz der gestiegenen Anzahl der erfassten Vorfälle, kann weiterhin von einer hohen Dunkelziffer von nicht gemeldeten rassistischen und antisemitischen Vorfällen ausgegangen werden, da nur die wenigsten Zwischenfälle den Weg in die Medien finden oder zur Anzeige gebracht werden.
Rechtsradikalismus/Extremismus
Im Verlauf des Jahres 2021 wurde in den Medien immer wieder von Aufmärschen und Zusammenkünften rechtsextremer Gruppen und Teilnahmen von Rechtsextremen an Coronademonstrationen berichtet. Wie viele andere Gruppierungen auch, versuchen Rechtsextreme von den aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie zu profitieren und ihre Reichweite zu erhöhen. Dabei unterwandern sie die Coronademonstrationen und marschieren mit der heterogenen Gruppe von Massnahmengegner:innen mit. Zwar besteht ein gewisses Potenzial, den Demonstrationszug als Rekrutierungsplattform zu nutzen, um für rechtsextremes Gedankengut zu werben, jedoch besteht hier eine geringere Gefahr, da eine seriöse Rekrutierung neuer Mitglieder einen längeren Beziehungsaufbau braucht (siehe ausführliches Interview mit dem Extremismusexperten Samuel Althof hier). Eine reale Gefahr sieht der Experte jedoch bei den Coronademonstrant:innen, welche mit ihren Diktaturvergleichen die Legitimität des Staates in Frage stellen. Mit diesem Verhalten rechtfertigen sie mögliche gewalttätige Ausschreitungen gegen Institutionen und Politiker:innen. Dies birgt stets dort eine Gefahr, wo der Staatsapparat per se zum Feind deklariert wird.
«Auffällig ist im Jahr 2021 die Häufung von Sachbeschädigungen und Schmierereien, bei denen nationalsozialistische Symbole wie das Hakenkreuz verwendet wurden.»
Ebenfalls kam es zu Aufmärschen von Rechtsextremisten, wie die Zusammenkunft zum Gedenken an die Schlacht von Sempach am Winkelried-Denkmal und die organisierte Wanderung einiger Mitglieder der «Jungen Tat» in Baselland. Die beobachteten Teilnehmerzahlen bei solchen Zusammenkünften sind in den vergangenen Jahren etwa gleichgeblieben. Im Vergleich zu Deutschland, bildet die rechtsextreme Szene in der Schweiz eher punktuell eine Gefahr. Auffällig ist im Jahr 2021 die Häufung von Sachbeschädigungen und Schmierereien, bei denen nationalsozialistische Symbole wie das Hakenkreuz verwendet wurden. Dabei wurden diese oftmals in Kombination mit Beschimpfungen oder Massnahmen- und Impfkritischen Aussagen kombiniert.
Antisemitismus
Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) gibt gemeinsam mit der GRA jährlich einen Antisemitismusbericht heraus, der einen Überblick über die registrierten antisemitischen Vorfälle und die aktuelle Lage in der Schweiz gibt. 2021 kam es zu einer Steigerung der registrierten antisemitischen Vorfälle. Zu dieser Steigerung haben sowohl antisemitische Zusendungen beigetragen, als auch vermehrt registrierte Vorfälle im Online-Bereich.
Antisemitische Vorfälle treten oft gehäuft auf, aufgrund sogenannter «Trigger». Der mit Abstand grösste Trigger im Jahr 2021 war weiterhin die COVID-19 Pandemie, neben der kurzzeitigen Eskalation des Nahost-Konflikts im Mai/Juni 2021. Etwa die Hälfte der registrierten Online-Vorfälle hatten zeitgenössische antisemitische Verschwörungsideologien zum Inhalt, wovon sich wiederum die Hälfte mehr oder weniger direkt auf die COVID-19 Pandemie bezog. Rund um die Corona-Massnahmen kam es zu einer Zunahme von Vergleichen mit der Schoah und dem nationalsozialistischen Regime. Diese Vergleiche sind nicht nur falsch, sie sind absurd und verwerflich. Auch wenn solche Vergleiche nicht per se antisemitisch sind, heizen diese dennoch die Stimmungslage auf und schaffen einen Nährboden für antisemitische Stereotypen und Vorurteile, die sich in Haltungen manifestieren können.
Anti-Schwarzen-Rassismus
Weiterhin sind Schwarze Menschen von rassistischen Vorfällen und Diskriminierung betroffen, häufig erleben sie verbale Attacken und Beschimpfungen. Im Jahr 2021 gab es erneut mehrere rassistische Vorfälle bei Fussballspielen. Schwarze Spieler wurden während und nach den Spielen von frustrierten Fans verbal im Stadion oder anschliessend in den Sozialen-Netzwerken attackiert. Obwohl einige Vorfälle von den Medien aufgegriffen wurden und es eine grosse Welle der Entrüstung gab, lassen langfristige Veränderungen oder Massnahmen zur Verhinderung solcher Aktionen auf sich warten. Als Reaktion auf die Häufung von rassistischen Vorfällen in Fussballstadien hat die GRA zusammen mit Züricher Politiker:innen, dem FC Hakoa und dem FC Kosova, im November 2021 ein Freundschaftsspiel organisiert, als Zeichen der Toleranz und Diversität.
Neben verbalen Attacken wurden vereinzelt auch tätliche Angriffe gegen Schwarze Menschen registriert. Ein besonders schwerer Vorfall ereignete sich im Oktober 2021 in St. Gallen, als ein Pensionär auf einen aus Eritrea stammenden Clubbesitzer zuging und diesem ohne Vorwarnung Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Dabei beschimpfte der ältere Mann den Clubbesitzer aufgrund seiner Hautfarbe und machte auch nach dem Eintreffen der Polizeibeamten, vor etlichen Augenzeugen, rassistische Aussagen. Die Staatsanwaltschaft befand den Pensionär der Tätlichkeiten, der Beschimpfung und des Aufrufs zur Rassendiskriminierung für schuldig und verurteilte diesen zu einer Geldstrafe.
Auch das letzte Jahr war geprägt von einer äusserst hitzig geführten Debatte über diskriminierende Begriffe. Dabei stand der Umgang mit problematischen Abbildungen und Bezeichnungen historischer Gebäude im Fokus. Die Stadt Zürich hat in diesem Zusammenhang beschlossen, Häusernamen, die das M-Wort enthalten, abzudecken und somit aus dem Stadtbild zu entfernen.
Antimuslimischer Rassismus
Wie der Bericht des Bundesamtes für Statistik (BFS) «Zusammenleben in der Schweiz» zeigt, ist die Bevölkerung gegenüber der muslimischen Gemeinschaft nach wie vor negativer eingestellt als gegenüber anderen Gruppen. Dies zeigte sich ebenfalls im Zusammenhang mit der «Verhüllungsverbotsinitiative». Wahlplakate, die für die Initiative warben, zeigten grimmig dreinblickende verhüllte Frauen zusammen mit dem Aufruf, den Extremismus zu stoppen. Bestehende Ressentiments sowie mögliche Ängste und Stereotype, die sich häufig generell gegen Muslim:as richten, wurden auf diese Weise mit Kampagnen in der Öffentlichkeit sowohl wiedergegeben als auch weiterhin geschürt. Punktuell ist es im Jahr 2021 zu antimuslimischen Vorfällen gekommen, die vor allem Frauen betrafen, die einen Hijab oder ein Kopftuch tragen. Dabei handelte es sich vordergründig um verbale Angriffe in der Öffentlichkeit.
Rassistische Meldungen
Neben den rassistischen Vorfällen, welche in den Medien aufgriffen wurden, gab es 2021 auch eine grosse Anzahl an Fällen, welche der GRA über die GRA-Webseite, per E-Mail oder telefonisch direkt gemeldet wurden. Neben zahlreichen Meldungen über rassistische oder antisemitische Inhalte und Kommentare im Online-Bereich, gab es im Jahr 2021 ebenfalls besonders viele Meldungen von rassistischen Vorfällen an Schulen, die der GRA direkt gemeldet wurden.
Rassismus an Schulen
Im Jahr 2021 wurden der GRA deutlich mehr rassistische Vorfälle an Schulen gemeldet als im vergangenen Jahr. Neben rassistischen Äusserungen waren es vermehrt auch Vorfälle, die rassistische und insbesondere nationalsozialistische Symbole und Gesten beinhalteten. Hier zeigt sich, dass sich in den Schulen die Vorgänge und Entwicklungen der Gesellschaft widerspiegeln. Unter Schüler:innen einer Schule im Kanton Zürich wurde der Hitlergruss zelebriert und Scherze über die Vergasung von Menschen in Konzentrationslagern während des Zweiten Weltkrieges, mit Anspielungen auf Personen von heute, gemacht. An einer anderen Schule im Kanton Schaffhausen streckten Lernende auf einem Velo ihre rechte Hand, statt zum Zwecke des Rechtsabbiegens, zu einem Hitlergruss aus. Ein weiterer Vorfall ereignete sich in einer 2. Sek. Klasse, bei dem die Lernenden bei einem Klassenfoto hochspringen und ihre Hände fröhlich in die Luft heben sollten. Einer der Lernenden zeigte bei dieser Gelegenheit den Hitlergruss. Meist sind Eltern in solchen Situationen verunsichert und wissen nicht, wie sie reagieren oder die Problematik ansprechen sollen, wenn sie von solchen Vorfällen an den Schulen ihrer Kinder erfahren. Doch auch Lehrpersonen wissen oftmals nicht, wie sie angemessen reagieren können. Dies zeigt ein Vorfall an einer Zürcher Schule, bei dem ein jüdischer Schüler nach den Frühjahrsferien auf seinem Pult ein eingeritztes Hakenkreuz vorfand. Die zuständige Lehrperson überklebte das nationalsozialistische Symbol und liess den Lernenden weiterhin an dem Pult arbeiten. Nachdem die Mutter des betroffenen Schülers interveniert hatte, wollte die Lehrperson den Tisch entfernen und in den Flur stellen, wo weitere Lernende mit dem überklebten Symbol konfrontiert wären.
«Im Jahr 2021 wurden der GRA deutlich mehr rassistische Vorfälle an Schulen gemeldet als im vergangenen Jahr.»
Auch wurden der GRA rassistische Vorfälle an Schulen gemeldet, bei denen Lernende aufgrund ihrer Hautfarbe beschimpft und diskriminiert wurden. Die GRA berät die Meldenden bei allen Vorfällen und die Partnerstiftung SET – Erziehung zur Toleranz übernimmt die Intervention vor Ort.
Um auch Anlaufstellen und Gefässe für Diskussionen vor Ort zu schaffen und Lehrpersonen sowie Lernende für die Themen Rassismus und Antisemitismus zu sensibilisieren und ihnen Tools an die Hand zu geben, wie sie auf rassistische Vorfälle an Schulen angemessen reagieren können, führt die GRA im Frühjahr 2022, während der Internationalen Anti-Rassismuswoche, den zweitägigen Workshop «Sparks – Zämä gege Rassismus» durch.
Des Weiteren nahm die GRA die andauernde Verbreitung von Verschwörungsideologien, mit antisemitischen Narrativen, zum Anlass einen neuen Informationsflyer für Lehrpersonen zu lancieren. Der Flyer zu «Verschwörungstheorien» klärt über die Mechanismen von Verschwörungsideologien auf, verweist auf ihre Gefahren und sensibilisiert für antisemitische Inhalte.
Die Sensibilisierung für Antisemitismus im Alltag, besonders im Sprachgebrauch, stand auch bei der Entwicklung des neuen Bildungstools «Antisemitismus im Alltag. Erkennen. Benennen. Reagieren.» im Mittelpunkt. Das Tool richtet sich speziell an junge Menschen und soll diesen ein Werkzeug an die Hand geben, mit welchem sie Antisemitismus im Alltag erkennen und angemessen darauf reagieren können.
Hate Speech
Einen grossen Teil der direkt an die GRA gemeldeten rassistischen Vorfälle betraf Hate Speech. Dabei handelte es sich meist um Meldungen von rassistischen Posts bzw. Kommentaren auf den Social Media Plattformen und Meldungen über rassistische Äusserungen in den Kommentarspalten von Online-Ausgaben von Zeitungen. Trotz definierter Nutzungsregeln, die die Social Media Plattformen für ihre Nutzer:innen aufgestellt haben, fallen zahlreiche rassistische und antisemitische Äusserungen durch das Raster und werden von den Verantwortlichen nicht gelöscht. Posts und Kommentare, die unterschwellig rassistisch bzw. antisemitisch sind oder beispielsweise den Holocaust verharmlosen, ohne diesen konkret zu leugnen, werden oftmals nicht gelöscht. Somit kursieren weiterhin zahlreiche rassistische und antisemitische Botschaften im Online-Bereich.
«Posts und Kommentare, die unterschwellig rassistisch bzw. antisemitisch sind, werden oftmals nicht gelöscht.»
Die gemeldeten Vorfälle spiegeln eine Entwicklung wider, welche die steigende Bedeutung von Hate Speech, insbesondere im Online-Bereich, aufzeigt. Als Reaktion auf diese Entwicklungen lancierte das EKR im November 2021 eine neue Meldeplattform für rassistische Online-Hassrede. Unter www.reportonlineracism.ch können dem EKR Vorfälle direkt gemeldet werden.
Schlussfolgerung
Die Ereignisse im Jahr 2021 verdeutlichen einmal mehr, wie vielschichtig Rassismus, Antisemitismus und andere Diskriminierungsformen sind, wo sie überall auftreten und wie komplex deren Bekämpfung ist. Vor allem die zahlreichen Vorfälle im Jahr 2021, bei denen nationalsozialistische Gesten und Symbole im Zentrum standen, zeigen, wie dringend es aktuell eine Debatte und mutige Stellungnahmen seitens der Politik braucht. Im Gegensatz zu Deutschland kennt die Schweiz kein konsequentes Verbot von nationalsozialistischen Symbolen und Gesten. Das öffentliche zur Schau stellen von Symbolen und Gesten, wie Hakenkreuze oder Hitlergruss, ist nur dann strafbar, wenn damit für eine Ideologie geworben wird. Die Meinungsfreiheit ist in der Schweiz ein hohes Gut, daher ist der Kontext, in welchem die Symbole und Gesten verwendet werden, stets zu beachten. Gleichzeitig ist es nicht von der Hand zu weisen, dass es sich bei den genannten Symbolen und Gesten um Sinnbilder einer Ideologie handelt, die mit den Grundprinzipien eines demokratischen Rechtsstaates nicht zu vereinbaren sind. Daher braucht es eine klare Rechtsgrundlage und eine klare Positionierung, die sich gegen rassistisch motivierten Hass stellt.
Nationalsozialistische Symbole und Gesten, wie das Hakenkreuz oder der Hitlergruss, haben in der Schweiz nichts verloren. Daher fordert die GRA mit der lancierten Petition den National- und Ständerat dazu auf, die drei eingereichten politischen Vorstösse anzunehmen. Gerade in einer Zeit, in der sich Vorfälle im Zusammenhang mit nationalsozialistischer Symbolik häufen, muss ein deutliches Zeichen gegen Rassismus und Antisemitismus gesetzt werden.
3. Interview mit Prof. Dr. iur. Daniel Jositsch über die aktuelle rechtliche Situation zum Verbot von nationalsozialistischen Symbolen
Herr Jositsch, Ende 2021 wurden gleich drei politische Vorstösse eingereicht, die ein Verbot von extremistischen oder nationalsozialistischen Symbolen fordern. Wie deuten Sie diese Entwicklung?
Parlamentarier:innen sind ein Sensor für den Zeitgeist und greifen jene Themen auf, die die Gesellschaft bewegen. Die Proteste gegen die Coronamassnahmen haben rechte Gruppierungen auf den Plan gerufen, die an Protesten mitlaufen. Gleichzeitig häufen sich bei diesen Protesten Vergleiche mit dem Nationalsozialismus, beispielsweise mit dem gelben Davidstern. Teile der Gesellschaft fordern daher ein klares Zeichen der Politik, welches mit diesen Vorstössen aufgegriffen wurde.
Ein Verbot nationalsozialistischer Symbole wird immer wieder diskutiert im Parlament. Vor 15 Jahren haben Sie sich ebenfalls für ein Verbot ausgesprochen, als dieses als Bundesratsvorlage in die Vernehmlassung ging. Am Schluss wurde das Thema aber versenkt. Wieso?
Dazu muss man die Entstehungsgeschichte der Rassismus-Strafnorm verstehen. Als diese Mitte der 90er Jahre dem Volk zur Abstimmung vorgelegt wurde, sahen bestimmte Kreise die Meinungsäusserungsfreiheit in Gefahr. Man entschied sich aus strategischen Gründen dazu, die Norm eher «schlank» zu halten, damit die Chancen einer Annahme an der Urne möglichst hoch sind. Schon damals erwog man aber eine mögliche Ergänzung für Symbole in Zukunft. Heute ist die Rassismus- Strafnorm weniger umstritten – eine Ergänzung daher vielleicht gar nicht so unrealistisch.
Wäre ein Verbot überhaupt umsetzbar?
Ich glaube in dieser Debatte ist es wichtig, dass man eine realistische Erwartungshaltung beibehält. Allein die Tatsache, dass solche Symbole konstant in leicht abgeänderter Form neu in Erscheinung treten, macht die Umsetzung eines Verbotes unglaublich schwierig. Die Erwartung, dass man bei einem Verbot solche Symbole nicht mehr sieht im öffentlichen Raum, ist unrealistisch. Wenn es aber vor allem darum geht, ein Zeichen zu setzen, dass menschenverachtende Ideologien nicht geduldet werden im öffentlichen Raum, dann kann ein Verbot durchaus Sinn ergeben. Schliesslich ist Geldwäscherei ja auch verboten, auch wenn diese damit nicht verhindert werden kann.
Wenn ein Gesetz allein nicht reicht, was braucht es zusätzlich zur Bekämpfung der Verbreitung und Anziehungskraft solcher Symbole?
Das beste und wohl nachhaltigste Mittel ist Präventions- und Bildungsarbeit. Die junge Generation muss genau wissen, wofür diese Symbole stehen und weshalb sie auf keinen Fall verharmlost oder für die eigene politische Agenda eingesetzt werden dürfen. Dieses Wissen muss so vermittelt werden, damit es die Lebensrealität junger Generationen auch anspricht.
Zur Person:
Prof. Dr. iur. Daniel Jositsch ist Ständerat und Professor für Aktuelle Vorstösse zum Verbot von Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität Zürich. Er ist zudem Mitglied der Staatspolitischen Kommission, Mitglied der Delegation bei der Interparlamentarischen Union und seit 2018 Vizepräsident der Sozialdemokratischen Fraktion.
Aktuelle Vorstösse zum Verbot von rassistischen Symbolen im Parlament:
Die von Marianne Binder-Keller eingereichte Motion «Keine Verherrlichung des Dritten Reiches – Nazisymbolik im öffentlichen Raum ausnahmslos verbieten» zielt darauf ab, eine eigenständige Grundlage zu schaffen, um die Verwendung von in der Öffentlichkeit bekannten Kennzeichen des Nationalsozialismus digital wie in der realen Welt zu verbieten und unter Strafe zu stellen
Mit der Parlamentarischen Initiative «Verbot der öffentlichen Verwendung von extremistischen, gewaltverherrlichenden und rassistischen Symbolen», eingereicht von Angelo Barrile, soll eine Anpassung der gesetzlichen Grundlagen erreicht werden, um die öffentliche Verwendung von Propagandamitteln, insbesondere des
Nationalsozialismus oder einer rassistisch motivierten Vereinigung unter Strafe zu stellen.
Die Parlamentarische Initiative «Öffentliche Verwendung und Verbreitung rassendiskriminierender Symbole in jedem Fall unter Strafe stellen», eingereicht von Gabriela Suter, zielt darauf ab, das Strafgesetzbuch dahingehend zu ergänzen, dass die öffentliche Verwendung oder Verbreitung von rassistischen Symbolen, nationalsozialistischen Symbolen im Besonderen, mit Busse bestraft werden, auch wenn diese ohne Werbecharakter präsentiert werden. Eine Ausnahme soll hier für die öffentliche Verwendung oder Verbreitung solcher Symbole zu wissenschaftlichen oder
schutzwürdigen kulturellen Zwecken gelten.
4. Interview mit dem Extremismusexperten Samuel Althof über die Macht von rassistischen Symbolen und ihrer Reichweite
Welchen Stellenwert nehmen Symbole ein, in extremistischen Kreisen?
Symbole sind für extremistische Gruppen ein wichtiger Bestandteil. Sie bieten Wiedererkennungswert, sie dienen der Abgrenzung und sie erzeugen einen äusserst wichtigen Binnendruck nach innen und haben somit grosse Kraft, die Gruppe zusammenzuhalten. Sie bergen also auch ein grosses Identifikationspotential.
Um was für Symbole handelt es sich? Lassen sich da bestimmte Muster erkennen?
«Klassische» Symbole der rechtsextremen Szene, wie etwa das Hakenkreuz oder die Rune, werden meist in abgewandelter Form weiterverbreitet. Dieses Phänomen macht denn auch die Frage der Strafbarkeit so komplex. Die Symbole sind also einerseits in konstantem Wandel, andererseits bleibt aber meist ein bestimmter Bezug zu den bekannten Symbolen, da damit eben auch eine gewisse «Abstammungslinie» gewahrt wird.
Wenn man von extremistischen Symbolen spricht, denken die meisten Menschen direkt an Hakenkreuze oder andere bekannte Symbole aus der rechtsextremen Szene. Wie relevant sind Symbole für linksextreme Kreise??
In beiden Szenen spielen Symbole eine wichtige Rolle. In der linksextremen Szene scheint aber eine grössere Konstanz oder Systematik zu herrschen. Dieselben Farbkonzepte und Logos werden kongruenter verwendet. Rechtsextreme Gruppierungen erscheinen fraktionierter. Dies hat sehr viel mit dem strafrechtlichen Verfolgungsdruck zu tun, der auf illegaler rechtsextremer Symbolik lastet. Die Gruppen wandeln Ihre Symbole immer wieder um oder erfinden diese bis zu einem gewissen Grad neu. Viele Klein- oder Untergruppen haben dann wiederum eigene Namen und ein eigenes «Logo». Diese Gruppen verschwinden meist so schnell, wie sie auch gekommen sind. Ihre «Lebensdauer» ist kurz.
Wo begegnet man diesen Symbolen? In welchen Räumen werden sie verbreitet?
Es lässt sich ein gewisses Wechselspiel zwischen dem Internet und der «realen» Welt feststellen. Die Symbole werden in Aktionen medienwirksam in Szene gesetzt. Das Ganze wird gefilmt und dann ins Internet gestellt, wo die Videos und Posts wiederum geteilt und gelikt werden. Im «besten» Fall berichten die Medien dann noch darüber und generieren damit noch mehr Aufmerksamkeit. Ein aktuelles Beispiel aus dem letzten Jahr: einige Jugendliche rollen, an einer exponierten Stelle, auf der Kornhausbrücke in Bern ein grosses Banner aus. Sie filmen und inszenieren sich dabei. Solche Stunts werden dann umgehend ins Internet gestellt und mittels YouTube verbreitet.
Wo sehen sie den Bezug zu den seit der Pandemie wieder weitverbreiteten Verschwörungsmythen?
Symbole sind ein zentrales Element der Kommunikation von Verschwörungstheorien. Denn genau wie die Verschwörungserzählungen selbst simplifizieren sie Sachverhalte in einfachen Grafiken. Damit wird in Gut und Böse kategorisiert, in dazugehörig und fremd. Gerade am Anfang der Pandemie kam es zu einer rasanten Verbreitung solcher Bilder auf Kommunikationskanälen wie Telegram. In der realen Welt hat das Symbol, des von den Nazis erfundenen gelben Davidsterns, mit der Aufschrift «ungeimpft», durch die Coronademonstrationen, eine grosse Polarisation und leider auch eine Schein- Opfer-Identifikation hervorgebracht. Sie sehen also, die Wirkung von Symbolen und was sie bei den Menschen auslöst sollte nicht unterschätzt werden.
Zur Person:
Samuel Althof ist Leiter der Fachstelle für Extremismus- und Gewaltprävention. Er führt zudem eine Praxis für psychologische Beratung in Basel, das «Büro für innere und äussere Angelegenheiten». Seit über 20 Jahren engagiert er sich gegen Rassismus im Internet und hilft bei Entwicklungen von Strategien im Umgang mit Rechts- und Linksextremisten.

Nationalsozialistische Symbolik verbieten
Zürich, 21. Februar 2022 – Vor kurzem hat der Bundesrat sich gegen ein konsequentes Verbot von Nazi-Symbolik im öffentlichen Raum ausgesprochen, nachdem Ende letzten Jahres gleich drei Parlamentarier:innen entsprechende Vorstösse eingereicht hatten. Dieser Entscheid des Bundesrates und vor allem auch seine Begründung stiessen bei vielen Menschen auf grosses Unverständnis.
Anders als in Deutschland gilt in der Schweiz kein generelles Verbot rechtsextremer Symbole oder Gesten. Wörtlich besagt die Rassismus-Strafnorm, dass sich strafbar macht, wer «öffentlich durch Wort, Schrift, Bild, Gebärden, Tätlichkeiten oder in anderer Weise eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung in einer gegen die Menschenwürde verstossenden Weise herabsetzt». Das Tragen eines Hakenkreuzes oder das Ausführen eines Hitlergrusses ist demnach nur dann strafbar, wenn damit eine menschenverachtende Ideologie, wie der Nationalsozialismus, aktiv beworben wird. Der Nachweis, dass dieses Moment vorliegt, ist zum Teil nur schwer zu erbringen. Richter:innen haben hier einen relativ weiten Interpretationsspielraum. Ob es sich bei einem Vorfall «lediglich» um ein persönliches Bekenntnis handelt oder um die Verbreitung einer Ideologie, entscheidet das zuständige Gericht nach eigenem Ermessen. An den unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten stossen sich zunehmend auch Politiker:innen.
Gerade bei Symbolen, die sinnbildlich für eine Ideologie stehen, die nicht mit den Grundprinzipien eines demokratischen Rechtsstaates zu vereinbaren sind, ist eine klare Rechtsgrundlage aber unabdingbar. Versuche zur Einführung eines generellen Verbotes menschenverachtender Symbole sind im Parlament bisher gescheitert. Ende letzten Jahres wurden gleich drei politische Vorstösse von Parlamentarier:innen eingereicht. Den Vorstoss von Marianne Binder-Keller, eine Forderung eines ausnahmslosen Verbots öffentlicher Zurschaustellung von Nazisymbolik, lehnte der Bundesrat nun ab. Seine Argumente sind jedoch fragwürdig.
Der Bundesrat hält an seiner Unterscheidung zwischen passiver Zurschaustellung und aktiver Werbung für nationalsozialistische Ideologien fest. Diese Unterscheidung ist jedoch völlig lebensfremd und rein theoretischer Natur. Zudem, so der Bundesrat, sei es «hinzunehmen, dass auch stossende Ansichten vertreten werden, selbst wenn sie für die Mehrheit unhaltbar sind.» Die Meinungsäusserungsfreiheit ist einer der höchsten Güter unserer Demokratie und muss, wann immer möglich gewahrt werden. Die Ideologie des Nationalsozialismus ist aber mehr als eine «stossende Ansicht». Der Nationalsozialismus und damit auch die Symbole, die für diese Ideologie stehen, spricht bestimmten Menschen, wie beispielsweise Jüdinnen und Juden, das Recht zu leben und Teil der Schweizer Gemeinschaft zu sein ab. Für betroffene Minderheiten bedeutet die öffentliche Zurschaustellung von rassistischen und nationalsozialistischen Symbolen einen direkten Angriff auf deren Integrität und Teilhabe an der Schweizer Gesellschaft.
In seiner Stellungnahme schreibt der Bundesrat zudem, dass «gegen die Verwendung von nationalsozialistischen Symbolen ohne Propagandazwecke Prävention geeigneter sei als straf-rechtliche Repression». Das eine schliesst das andere jedoch nicht aus, es braucht beide Komponenten – die Prävention und ein Verbot inklusive klarer Strafbestimmung.
Die GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus lancierte nach dem Entscheid des Bundesrates am 15. Februar 2022 eine Online-Petition. Mit dieser werden die Mitglieder des National- und Ständerats dazu aufgefordert, die Ende letzten Jahres eingereichten politischen Vorstösse anzunehmen und damit ein unmissverständliches Zeichen gegen Rassismus und Antisemitismus zu setzen. Die GMS unterstützt diese Petition. Es wird Zeit, dass die Politik die gegenwärtig unbefriedigende Unterscheidung zwischen aktivem Werben und passivem Zurschaustellen der eigenen extremistischen Haltung durch entsprechende Symbole unter die Lupe nimmt und eine klare Rechtsgrundlage schafft. Diese Klärung wäre nicht nur ein Zeichen für den Schutz von Minderheiten, die sich durch entsprechende Symbole direkt bedroht sehen, sondern auch ein wichtiges Bekenntnis zum Demokratieverständnis der Schweiz.

Einladung Veranstaltung “Jenisches Leben Heute”
Wussten Sie, dass die Jenischen seit hunderten von Jahren in der Schweiz leben? Bis in die Siebzigerjahre haben die Schweizer Behörden die fahrende Lebensweise aktiv versucht zu unterdrücken. Heute leben rund 30’000 Jenische in der Schweiz. Die diesjährige Mitgliederversammlung der Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz (GMS) widmet sich dem Thema “Jenisches Leben Heute”.
Nach der diesjährigen Mitgliederversammlung der GMS am 25. Juni 2024 laden wir zur öffentlichen Veranstaltung “Jenisches Leben Heute” ein.
Zunächst wird ein Inputvortrag zum Thema «Jenisches Leben Heute» von Venanz Nobel, Vertreter der jenischen Gemeinschaft, gehalten. Danach folgt eine Podiumsdiskussion mit den Filmemachern von «Ruäch – Eine Reise ins jenische Europa» und Herrn Nobel. Die Diskussion wird angereichert mit Ausschnitten aus dem Film.
Es folgt ein Apéro mit der Möglichkeit zum weiteren Austausch.
Kommen Sie gerne und bringen Sie andere Interessierte mit!
Datum: 25. Juni 2024
Zeit: 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr inkl. Apéro
Ort: Pädagogische Hochschule Zürich, Raum: LAA-J002C, Lagerstrasse 2, 8090 Zürich
Hier können Sie sich für die Veranstaltung anmelden: RSVP Formular





